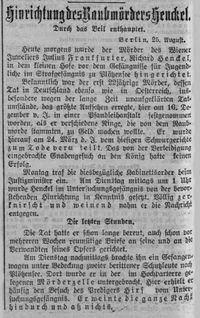1. Der Fall - Karl Haidinger
Am 1. August 1919 wurde das Haus Grieshofgasse 20 in Meidling Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Hier lebte der Buchbindergehilfe Karl Haidinger in der Wohnung seiner Stiefeltern.
Bereits seit einigen Tagen hatte der beschäftigungslose Mann ein Kind aus der Nachbarschaft, die 9-jährige Charlotte Karl, beobachtet und in immer stärkerem Maße ein perverses Verlangen gespürt, das Mädchen zu besitzen und zu töten.
Am Morgen des 1. August sprach er das Kind auf der Straße an und bat es, ihm eine Zeitung zu besorgen und in die Wohnung zu bringen. Das brave Mädchen entsprach diesem Wunsch. Als es jedoch an der Tür abgeben wollte, zerrte Haidinger das Kind in die Wohnung, wo er es knebelte und notzüchtigte. Dann erdrosselte er die kleine Charlotte mit seinem Gürtel und verbarg die Leiche in einem Wäschekoffer. Einige Stunden später entdeckte der von der Arbeit heimkommende Stiefvater die Leiche des ermordeten Kindes und erstattete sofort Anzeige, wobei er gegenüber der Polizei den Verdacht äußerte, dass sein Stiefsohn die schreckliche Tat begangen haben könnte. Haidinger irrte inzwischen planlos in der Stadt umher. Die Polizeiagenten konnten allerdings in Erfahrung bringen, dass sich der Gesuchte fast regelmäßig am Abend in der Nähe der Prostituierten an der Ecke des Gürtels und der Mariahilferstraße herumtreibe.
Tatsächlich gelang es, den Mörder auch an diesem Abend wieder am angegebenen Ort zu finden und zu verhaften, er war sofort und ohne Reue zu einem Geständnis bereit. Eines der furchtbarsten Verbrechen dieses Jahres konnte somit noch am Tage der Tat geklärt werden.
Karl Haidinger wurde im folgenden Verfahren von den Geschworenen in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden.
Das Urteil lautete auf achtzehn Jahre schweren Kerker. Es war das erste Mal nach der Aussetzung der Todesstrafe in Österreich, das von vielen Menschen dieser Regierungsbeschluss zutiefst bedauert wurde.
Quellen: - Tatort Wien, der neue Wiener Pitaval, Dokumentation der bedeutendsten Kriminalfälle Wiens des 20. Jahrhunderts (1. Band) – Die Zeit von 1900 – 1924 (von Edelbacher / Seyrl) Ausgabe 2005 – S. 196 - ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com
2. Der Fall - Johann Beck
Am 18. Dezember 1911 wurde das Gastzimmer im „Schwarzen Adler“ in der Schwendergasse 41 in Wien-Fünfhaus der Schauplatz einer dramatischen Bluttat.
Zwei alte Freunde, der Obsthändler Johann Beck und der Markthelfer Karl Hager waren lange bei einem Umtrunk beieinander gesessen. Sie hatten die Absicht, einen Streit beizulegen, der die alte Freundschaft in letzter Zeit getrübt hatte. Es war ein ruhiges Gespräch und alle Tischnachbarn hatten den Eindruck, dass der Friede nun wieder hergestellt sei. Da erhob sich plötzlich Beck, griff in die Tasche, zog einen Browning und erschoss aus allernächster Nähe seinen Freund. Dann verließ er, von keinem der erstarrten Gasthausbesucher daran gehindert, den „Schwarzen Adler“.
Bereits am nächsten Tag traf ein berittener Sicherheitswachmann am Satzberg am Hütteldorf auf einen Mann – den flüchtigen Johann Beck. Beck entzog sich jedoch der irdischen Gerechtigkeit. In einer Zelle des Landgerichtes beging er noch in der Untersuchungshaft Selbstmord.
Quellen: - Tatort Wien, der neue Wiener Pitaval, Dokumentation der bedeutendsten Kriminalfälle Wiens des 20. Jahrhunderts (1. Band) – Die Zeit von 1900 – 1924 (von Edelbacher / Seyrl) Ausgabe 2005 – S. 230 - ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com
3. Der Fall - Rosalia Plössl
Der Spittelberg war schon immer Schauplatz des Wiener Kriminalgeschehens gewesen, so auch an jenem 21. August des Jahres 1915.
Im Haus Kirchberggasse 19 wohnte das Arbeiterehepaar Plössl. Alexander Plössl war ein fleißiger Gerüstarbeiter, der oft auch noch nach Feierabend diverse Arbeiten verrichtete, um einige Kronen mehr zu verdienen. Diese Abwesenheit am Abend führte bei seiner Frau Rosalia immer wieder zu heftigen Eifersuchtsausbrüchen, da sie ihrem Mann Beziehungen zu anderen Frauen unterstellte. Diese völlig unbegründeten Eifersuchtsszenen erschwerten dem braven Mann das Leben und es kam immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen des Paares.
Am 21. August, einem Samstag, legte sich Alexander Plössl zum Mittagsschlaf nieder, als plötzlich seine Frau mit einem Kübel heißer, hochkonzentrierter Lauge vor ihm stand und ihn damit übergoss. Die Lauge drang in Rachen und Nase des Mannes und wenig später erlag Alexander Plössl den schweren Verätzungen. Noch zwei Nächte verbrachte die Täterin an der Seite der Leiche, bis sie den Weg zur Polizei wählte und Selbstanzeige machte.
Das Gericht akzeptierte die Verantwortung der Frau und Rosalie Plössl wurde nur des Totschlages für schuldig befunden und zu drei Jahren schweren Kerker verurteilt. Die Selbststellung und das reuige Verhalten hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Milde der Justiz.
Quellen: - Tatort Wien (1. Band – Die Zeit von 1900 – 1924) von Edelbacher/Seyrl – Ausgabe 2004 – S.146 – ISBN 3-911697-09-8 + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com
4. Der Fall - Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar
Am Donnerstag, den 2. April 1908, fand in Bonn eine dreifache Hinrichtung statt. Die kroatischen Bergleute Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar wurden wegen Raubmordes enthauptet. Baic hatte mit zwei weiteren Komplizen, Rupcic und Obred Kokotovic, am 19. Juli 1907 die Wirtsleute Raaf und die 86 Jahre alte Witwe Lohmar in Burbusch ermordet. Beslac und Kantar hatten sie dazu angestiftet.
Die Männer hatten schon mehrfach in der Wirtschaft der Raafs Karten gespielt, um eine Gelegenheit für den Raubüberfall auszukundschaften. In der Nacht des 19. juli drangen sie in das einsam gelegene Haus ein, Baic tötete den 60jährigen Wirt und dessen Tante mit Messerstichen, Rupcic ermordete die 54jährige Wirtin. Sie erbeuteten 330 Reichsmark. Das Schwurgericht in Bonn verurteilte alle fünf am 27. Oktober 1907 zum Tode; noch in der gleichen Nacht erhängte sich Rupcic in seiner Zelle. Obred Kokotovic wurde kurz vor der Hinrichtung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe begnadigt, doch verzichtete Kaiser Wilhelm II. am 16. März auf sein Gnadenrecht für die drei anderen Männer. Am 2. April 1908, um 6 Uhr morgens, wurden Nikolaus Baic, Daniel Beslac und Milos Kantar, im Abstand weniger Minuten, auf dem Gefängnishof in Bonn durch Scharfrichter Gröpler mit der Guillotine enthauptet.
Quellen: - todesstrafen.de
5. Der Fall – Aicher-Sepp und Hofer-Sepp
Der November 1918 war wahrlich keine Zeit zum Feiern. Der 1. Weltkrieg mit seinen Millionen Toten war gerade zu Ende gegangen, der schrecklichste Hungerwinter der jüngeren Geschichte stand erst noch bevor. Aber wer sonst nichts hatte, der hatte das nackte Leben gerettet. Und das war vor allem für die heimkehrenden Soldaten gar nicht wenig.
Im Gasthaus Holler in Steinbruch nächst Pürnstein fand deshalb am 24. November ein Heimkehrerfest statt. Im ersten Zimmer wurde getanzt, im Nebenzimmer unterhielt man sich auch ohne Musik. Zu den Gästen des Festes gehörte auch der 36-jährige Johann Neubauer, Besitzer des Maierhofes in Pürnstein. Neubauer stammte eigentlich aus Leopoldschlag, wo er acht Jahre lang das Zachlergut bewirtschaftet hatte. 1917 hatte er ein Bauerngut in Dietach gekauft und seit dem Frühjahr 1918 gehörte ihm auch der Maierhof in Pürnstein. Den hatte er zwar verpachtet, aber trotzdem sah er so alle zwei Wochen einmal nach dem Rechten.
Josef Neubauer war also ein reicher Mann. Und er zeigte es auch gerne. Aus Angst vor einem Einbruch führte er stets den größten Teil seiner Barschaft mit sich. Häufig wies er den Leuten seine gefüllte Brieftasche vor, in der sich meist zwischen 30.000 und 40.000 Kronen befanden. Vorsichtshalber trug er unter dem Hemd in einem Zwilchsäckchen meist noch einmal ungefähr dieselbe Summe. Neubauer hatte sich gut unterhalten, beim Zahlen seine Tausender hergezeigt und gegen drei Uhr früh den Heimweg angetreten. Eine halbe Stunde später traten auch Katharina und Maria Bruckmüller, Josef Grünzweil und Josef Ott den Heimweg an. Auf halbem Weg zwischen Steinbruch und Pürnstein fanden sie im Straßengraben Johann Neubauer, der in einer Blutlache lag und keine Lebenszeichen mehr von sich gab.
Die Gendarmerie und die bald darauf eintreffende Gerichtskommission aus Neufelden stellten zunächst fest, dass die Leiche ursprünglich auf der Strasse gelegen war. Die Weste des Ermordeten war leer, unter der Leiche fanden sich jedoch seine Briefschaften und ein Reisepass. Das Zwilchsäckchen mit 36.000 Kronen war noch vorhanden. Das Gesicht war vielfach verletzt, die Gurgel durchschnitten.
Bei der Obduktion wurden insgesamt drei Schussverletzungen festgestellt. Ein Schuss war offenbar von hinten aus unmittelbarer Nähe abgefeuert worden, einer hatte die Hand – vermutlich während einer Abwehrbewegung – getroffen, und der dritte war erst abgefeuert worden, als Neubauer schon auf dem Boden lag. Außerdem wies die Leiche 19 Stichwunden auf, zwei abgebrochenen Messerspitzen steckten noch im Kopf.
Den Gästen war aufgefallen, dass die beiden Cousins, die bei Josef Brandl hießen und die man deshalb nur durch ihre Hausnamen auseinander halten konnte, fast gleichzeitig mit Josef Neubauer das Wirtshaus verlassen hatten. Der Aicher-Sepp und der Hofer-Sepp, beide als flotte Tänzer bekannt, hatten sich an diesem Abend auch kaum am Tanz beteiligt. Zudem hatte der Vater des Hofer-Sepp, der Hoferbauer, erst kürzlich mit Josef Neubauer einen Pferdehandel getätigt, bei dem er sich letztlich ziemlich beschissen vorgekommen war.
Sofort durchgeführte Hausdurchsuchungen erhärteten den Verdacht: Beim Hoferbauern fand man einen Revolver samt Stahlmantelmunition, die von den Tatprojektilen nicht zu unterscheiden war. Die beiden Vettern wurden verhaftet, leugneten aber standhaft. Endlich wurde ein Brief des Hofer-Sepp abgefangen, in dem er seine Schwester bat, sie solle knapp 2.000 Kronen, die er hinter einer Nebentür des Hofer-Anwesens versteckt habe, verschwinden lassen, weil der sonst 20 -30 Jahre Kerker bekommen könne oder gar aufgehängt würde. Ein Untersuchungsrichter fand dort tatsächlich den erwähnten Betrag. Von da an simulierte er vorwiegend Wahnsinn, während sein Vetter, der Aicher-Sepp ein teilweises Geständnis ablegte, den Großteil der Verantwortung für das Verbrechen aber dem Hofer-Sepp zuschob.
Der legte schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Demnach war die Tat bereits seit acht Tagen geplant gewesen, und zwar teils aus Rache wegen des Pferdehandels, teils aus Geldgier. Nachdem sie auf Neubauer drei Schüsse abgegeben hatten, habe der noch immer mit Händen und Füßen um sich geschlagen, worauf ihm der Aicher-Sepp die Gurgel durchgeschnitten und noch weitere Messerstiche versetzt habe. Auch er, Hofer-Sepp, habe mindestens noch ein Mal gegen Neubauer losgestochen, wobei ihm das Messer abgebrochen sei.
Nachdem die Geschworenen die Schuldfrage der beiden einstimmig bejaht hatten, wurde Hofer-Sepp zu 20 Jahren, Aicher-Sepp zu 15 Jahren schweren und verschärften Kerkers verurteilt.
Quellen: - Arsen im Mohnknödel (von Franz Steinmaßl) Ausgabe 1992 - S.31 – ISBN 3-900948-13-3
6. Der Fall - Gustav Allram
Tod statt Schandlohn
Sie fragte nach dem Schandlohn: „Schenkst du mir was?“ Doch er hatte kein Geld. Da geriet sie in Wut und beschimpfte ihn. Er war in seiner Ehre gekränkt und griff nach ihrem Hals.
Die an grausigen Verbrechen so reiche Kriminalchronik ist durch eine furchtbare Bluttat um einen neuen Fall in trauriger Weise vermehrt worden...“, beginnt die Illustrierte Kronen Zeitung vom 13. Mai 1910 ihren vierundeinhalb Seiten langen Bericht über den Mord an einer jungen Frau und führt uns in ein Hotel, das in gewöhnlichen Reiseführern keine Erwähnung findet. Für die Frauen, die in so einem Hotel wohnen, ist das Zimmer auch mehr Arbeitsplatz, als der Ort zum Ausruhen.
„Unter der würgenden Hand eines beutegierigen Mordgesellen...“, setzt die Illustrierte Kronenzeitung fort: „...hat das unter sittenpolizeilicher Aufsicht stehende Mädchen, Leopoldine Piller, den Tod gefunden. Der Mörder, der die Untat so rasch und kaltblütig verübte, dass eine im Nebenzimmer weilende Bedienerin nichts Verdächtiges vernahm, hat die Flucht ergriffen.“
Wien - Der Graben (1911)
Flucht durchs Fenster
Die erwähnte Bedienerin Marie Raudenkolb wachte in der Nacht des 12. Mai 1910 gegen Viertel eins auf, als Leopoldine Piller in Begleitung eines jungen Mannes das Hotel in der Rueppgasse im 2. Wiener Gemeindebezirk betrat. Als Raudenkolb, die sogleich wieder einschlief, von einem jungen Mann geweckt wurde, wusste sie im Moment nicht, ob sie eine Stunde oder länger geschlafen hatte. Der junge Mann, Marie Raudenkolb blieb sich da ganz sicher, dass es der Begleiter der Piller war, welcher von ihr Zigaretten wollte. Doch Raudenkolb lehnte ab, diese zu besorgen. Irgendwie kam es der Bedienerin komisch vor, dass der junge Bursche so stillschweigend ihre Ablehnung akzeptierte. Sie hatte sich schon auf eine heftige Diskussion eingestellt. „Seltsam, dass der so einfach wieder ins Zimmer gegangen ist“, sagte sie zur Hausbesorgerin, die sie sogleich aufgesucht hatte. Aufwecken musste sie sie gar nicht, denn die Hausbesorgerin war munter, weil auch ihr was komisch vorgekommen war. „Es is' jetzt grad ein junger Bursch' aus dem Zimmer von der Piller g'kommen. Aber nicht durch die Tür, na, er is' durch's Fenster in den Hof g'sprungen.“
Die beiden Frauen waren sich sofort einig, bei Piller Nachschau zu halten und liefen zu dem ebenerdig gelegenen Zimmer. Die Tür war nicht versperrt, sie konnten ungehindert eintreten. Leopoldine Piller lag regungslos rücklings quer über den im Zimmer stehenden Diwan. Sie war etwas hinuntergerutscht, so dass ihr Kopf auf der Rückenlehne zu liegen kam, der linke Fuß hing auf den Fußboden hinab. Piller regte sich nicht, auch nicht auf die wiederholten Rufe der beiden Frauen, die Schrecklichstes ahnten und sich nicht getrauten, die junge Frau anzugreifen.
Die Polizei ermittelt
Der verständigte Inspektionsarzt der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft konnte nur noch den Tod des unglücklichen Mädchens feststellen. Auch fielen ihm Verfärbungen am Hals der Frau auf, die er richtigerweise als Würgemale deutete. Umgehend nahm die Polizei die Erhebungen auf. Vom Gang betrat man zuerst eine kleine Küche, durch die man in das Zimmer gelangte, von dem ein großes Fenster in den Hof führte. Das Fenster war etwa einen Meter über Bodenhöhe des Hofes und von einem Spitzenvorhang beinahe zur Gänze verdeckt.
Die Leiche der Leopoldine Piller.
Die Einrichtung war einfach, in der Mitte ein Tisch, darüber eine Hängelampe. Rechts vom Fenster stand ein Bett, und auf der anderen Seite ein lederüberzogener Diwan. Auf einem kleinen Tischchen stand eine künstliche Palme, so wie sich weitere Kunstblumen im Zimmer befanden. An den Wänden hingen Bilder mit orientalischen Darstellungen und, wie es in der Tatortbeschreibung festgehalten wurde, überall fand sich verschiedener Krimskrams, wie er in solchen Etablissements häufig vorzufinden war, um eine gewisse Eleganz vorzutäuschen.
Marie Raudenkolb berichtete, dass Leopoldine Piller am Vortag gegen 10 Uhr abends das Haus verlassen hatte. Das war für das Mädchen die übliche Zeit, um Herrenbekanntschaften zu suchen. Sie hatte nie viel Geld bei sich und dürfte an diesem Abend höchstens 2 Kronen in ihrer Brieftasche bei sich getragen haben.
Davon hatte sie einen Teil in verschiedenen Lokalen ausgegeben. Gegen Mitternacht musste sie wohl mit dem jungen Burschen in Kontakt gekommen sein, der sie nach Hause begleitet hatte. Kurz nachdem die beiden ins Zimmer gegangen waren, war es zum Mord an der jungen Prostituierten gekommen.
Der Amtsarzt besichtige nun die Leiche und stellte deutliche Anzeichen von Würgespuren fest. Aufgrund der Tatortsituation musste angenommen werden, dass das Opfer keine Gegenwehr geleistet hatte.
Aviso an Juweliere...
Die einzige Verletzung, abgesehen von den Würgemalen, die am Opfer festgestellt werden konnten, war am linken Ohrläppchen zu finden. Der Täter hatte die jungen Frau beim herunterreißen des Ohrsteckers verletzt. Weiters wurden dem Mädchen die Ringe von den Fingern gezogen und das verbliebene Bargeld von nicht mehr als einer Krone gestohlen. „...ob einer geringen Beute Willen musste das Mädchen den Tod finden...,“ formulierten die Zeitungen, denn auch die Schmuckstücke waren nicht von großem Wert, weil sie allesamt unecht waren.
Die einzigen Spuren, die der flüchtende Täter hinterlassen hatte, waren eine grüne Ansteckmasche mit schwarzen wellenförmigen Streifen und ein kaputter Schirm. Die Hausbesorgerin und die Bedienerin beschrieben den Flüchtigen als 20-jährig, vielleicht wenige Jahre älter, auffallend klein mit blassem Gesicht, dunklen Haaren und Schnurrbart. Da von den Schmuckstücken sehr genaue Beschreibungen vorlagen, erhoffte die Polizei über das gestohlene Gut bald etwas vom Täter hören zu können, zumal er offensichtlich den Wert höher eingeschätzt haben dürfte. Die Polizei gab Beschreibungen der gestohlenen Schmuckstücke an Juweliere, Trödler und Pfandleihanstalten weiter, mit dem Ersuchen, Personen, die ähnliche Schmuckstücke verkaufen oder versetzen wollten, festzuhalten und die Polizei zu verständigen:
„Aviso für die Herren Juweliere, Gold- und Silberarbeiter, Trödler, Inhaber und Schätzmeister von Pfandleihanstalten. Heute Nacht wurde im 2. Bezirk ein Raubmord verübt und dabei 2 Neugoldringe mit je 1 falschen weißen Stein und 1 Paar goldene Ohrgehänge, gleichfalls mit falschen weißen Steinen, in Silber gefasst, geraubt. Es wird eindringlich ersucht, genaue Nachschau zu halten, ob diese Schmuckgegenstände nicht bereits angekauft oder belehnt worden sind, bejahenden Falls wird unverzügliche Mitteilung erbeten. Verneinenden Falles wolle dem etwaigen Vorkommen dieser Gegenstände die größte Aufmerksamkeit zugewendet und die Anhaltung des Vorzeigers veranlasst werden.“
Piller wurde in Bayern geboren
Leopoldine Piller wurde am 26. November 1881 in einem kleinen Ort nahe Regensburg in Bayern geboren. Sie entstammte einer armen Familie, in der jeder mithelfen musste, um den ohnedies schon geringen Lebensstandard zu halten. Leopoldine war von schwächlicher Natur und konnte keine schwere Arbeit leisten. Bald verließ sie das ärmliche Elternhaus und versuchte ihr Glück in der Fremde. In verschiedenen Städten suchte sie eine Anstellung zu finden, doch schien sie immer zu schwach und wurde weitergewiesen. 1902 kam sie voller Hoffnung nach Wien und träumte von einer redlichen Arbeit. Doch keiner behielt sie lange, sie war zu schwach, die Anforderungen körperlich zu erfüllen und sehr bald stand sie wieder auf der Straße. Sie klagte einer Freundin ihr Leid. Leopoldine Piller folgte dem Rat der Freundin und stellte sich in einem kleinen Hotel vor, ohne zu ahnen, wohin sie gekommen war. Doch sie hatte so viele Rückschläge und Enttäuschungen erlebt, dass sie nun bereit war, sich selbst anzubieten und sie begann, als Prostituierte zu arbeiten.
60 Heller für einen „falschen“ Ring
Anna Klitschka putzte am 13. Mai gegen sieben Uhr die Auslagenscheiben eines Geschäftes in der Schulgasse, als sie ein junger Mann ansprach und ihr einen Ring mit falschem Stein um 1 Krone 20 Heller anbot. Klitschka wollte ihm lediglich 60 Heller zahlen, womit sich der Unbekannte zufrieden gab.
Gustav Allram
Kurz danach kam die Chefin in das Geschäft und erzählte von dem ruchlosen Mörder aus der Rueppgasse. Klitschka war erschrocken, als sie vom „falschen Schmuck“ hörte. Umgehend lief Klitschka mit dem Corpus delicti zum Wachzimmer und legte ihn auf den Tisch. Die Beschreibung des Verkäufers passte zu den bereits bekannten Angaben hinsichtlich des Flüchtigen aus der Rueppgasse. Auch konnte der Ring eindeutig identifiziert werden.
Alle Polizisten Wiens waren mit genauen Beschreibungen des mutmaßlichen Täters ausgestattet und hatten den Auftrag, jedes Individuum, auf das diese Beschreibung passte, zur Ausweisleistung anzuhalten und im Verdachtsfalle auf das nächste Wachzimmer zu bringen. Die beiden Sicherheitswachleute Salomon und Kaufmann patrouillierten gegen zwei Uhr nachts durch die Römergasse im 16. Bezirk. Während Salomon auf der linken Seite ging, befand sich der zweite Beamte auf der gegenüberliegenden Seite. Sie waren schon einige Zeit unterwegs und hatte sich nichts Auffälliges ergeben, als sich Kaufmann ein junger Bursche näherte, der beim Anblick des Polizisten die Straßenseite wechselte, damit allerdings nur erreichte, direkt in die Arme des Wachmannes Salomon zu laufen. Das Aussehen des jungen Mannes passte auf die Beschreibung des Gesuchten und das Verhalten war auch ausreichend auffällig, sodass er auf das Wachzimmer Wilhelminenstraße gebracht wurde.
Der junge Mann hieß Gustav Allram und wohnte unweit des Aufgriffortes. Sein Verhalten erklärte er damit, dass er schon von diesem Mord gehört und auch die Beschreibung des Verdächtigen gelesen hatte. Er war der Meinung, eine gewisse Ähnlichkeit zu haben und wollte Unannehmlichkeiten ausweichen, als er dem Wachmann begegnete. Er selbst wollte mit der Tat nichts zu tun haben. Am Vormittag des darauffolgenden Tages wurde Allram dem Sicherheitsbüro überstellt. Zugleich wurde der Vater des Festgehaltenen verständigt, der sich unverzüglich in das Sicherheitsbüro begab ohne zu wissen, worum es diesmal ging. Gustav hatte ihm schon manche Sorgen bereitet, es war sogar wiederholt notwendig, den Buben in die Landesheil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof“ einzuweisen, erst ein Jahr zuvor war er als geheilt entlassen worden. Seither war er beschäftigungslos, lungerte herum und ließ sich von seinen Eltern aushalten.
Die Gegenüberstellung
Bevor man die erste Einvernahme vornahm, wurde Gustav Allram von zwei Kriminalbeamten in die Rueppgasse gebracht und der Hausbesorgerin und der Bedienerin gegenübergestellt. Als die beiden Frauen den jungen Mann erblickten, erklärten sie übereinstimmend, ihn nicht als den letzten Gast der Piller erkennen zu können. Auch eine andere Prostituierte hatte den letzten Gast gesehen und Allram wurde ihr gegenübergestellt. Auch sie erklärte, dass der Verdächtige anders ausgesehen hatte, als der junge Mann, der ihr nun gegenüberstand. Der Polizeiagent verständigte umgehend das Sicherheitsbüro und ersucht um weitere Instruktionen. Trotz des negativen Ergebnisses wurde angeordnet, Allram wieder zurück zu bringen.
Das Verhör
Polizeikommissär Dr. Gans war sich sicher, in Allram den Mörder der Piller zu haben und unterzog ihn sofort einem Verhör. Allram saß dem Beamten gegenüber. Keiner sprach ein Wort. Allram wusste nicht, ob er was sagen sollte, sich beschweren sollte, weiter wie ein Verdächtiger behandelt zu werden, wenn ihn doch keiner in der Rueppgasse als den Verdächtigen agnosziert hatte. Unvermittelt sprach ihn der Beamte scharf an: „Sie kommen mir bedenklich vor!“ - Ich war's nicht, Herr Kommissär!“, stieß Allram aufgeregt hervor. „Gustav Allram wurde immer nervöser und begann sich wiederholt zu korrigieren. Auch machte es ihn unruhig, weil ihn Dr. Gans unentwegt starr anblickte. Dr. Gans ließ keine auch nur so geringe Reaktion unbeobachtet. Ihm fiel ein offensichtlich frischer Kratzer unter dem linken Auge auf: „Woher haben Sie den Kratzer?“, fragte er Allram unvermittelt. „Ich ging im Walde spazieren und streifte an einem Baumzweig.“ Dr. Gans fragte weiter, wann dieser Spaziergang war, in welchem Wald, zu welcher Uhrzeit und nach sonstigen unbedeutenden Nebensächlichkeiten. Allram versuchte auf alles eine Antwort zu geben. „Ist das denn so wichtig?“, wollte er das Thema wieder in eine andere Richtung lenken, weil er merkte, die Übersicht zu verlieren. Der Beamte ließ nicht locker, er lies alles immer wieder in allen Einzelheiten erzählen.
Das Geständnis
Gustav Allram gab plötzlich auf eine gar nicht gestellte Frage fast schon schreiend eine Antwort: „Nun ja, ich war's!“ - Dem Leiter des Sicherheitsbüros wurde mitgeteilt, dass Allram den Mord gestanden hatte. In der darauf folgenden Einvernahme legte er ein umfassendes Geständnis ab.
Gustav Allram war von Leopoldine Piller angesprochen worden und auf ihr Zimmer mitgekommen. Sie hatte ihren Hut und Mantel abgelegt und sich auf das Sofa gesetzt. Auch er hatte es sich bequem gemacht und neben das junge Mädchen gesetzt. Er war etwas nähergerutscht und hatte seinen Arm um sie legen wollen, worauf sie ihn zurückgewiesen und gefragt hatte: „Schenkst du mir was?“ Allram hatte entgegnet: „Ich hab' doch kein Geld!“ Erbost war das Mädchen aufgesprungen und hatte ihn angeschrien: „Und da kommst du zu mir? Du Pülcher! Ich lass jetzt einen Wachmann kommen und dich verschütten!“ Allram war in heftige Erregung geraten und hatte sich auf Piller gestürzt. Mit der rechten Hand hatte er ihren Hals umfasst und zugedrückt. Er hatte so lange zugedrückt, gab er in seiner Einvernahme an, bis sich das Mädchen nicht mehr gerührt hatte. Als sie kraftlos zurückgefallen war, hatte er begriffen, was er getan hatte. Er hatte überlegt, wie er aus dem Haus gelangen konnte und hatte die Bedienerin um Zigaretten ersucht, damit sie das Haus hätte verlassen müssen. Doch die Frau war nicht gegangen, so war er wieder zurückgekehrt. Erst jetzt war ihm der Gedanke gekommen, den Schmuck des Mädchens an sich zu nehmen. Er war an den Diwan herangetreten und hatte den ersten Ring abziehen wollen, als er gesehen hatte, dass Piller atmete.
Wieder hatte er sie am Hals gepackt und eine Zeitlang festgehalten. Wie lange, konnte er in Minuten nicht angeben, jedenfalls beschrieb er, solange, bis er sich sicher gewesen war, dass das Opfer nicht mehr gelebt hatte. Erst jetzt hatte er sein Werk vollenden können und Schmuck und Geld an sich genommen. Er hatte nicht erkannt, dass es sich um unechten Schmuck gehandelt hatte. Da er keinen anderen Fluchtweg gesehen hatte, musste er das Zimmer der Piller durch das Fenster verlassen.
Markt (1911) in der Nähe der Rueppgasse in Wien im 2. Gemeindebezirk
Auf der Flucht
Allram war durch das nächtliche Wien in Richtung Volkertplatz gelaufen und von dort weiter zum Nordwestbahnhof und über die Nordbahnbrücke nach Jedlesee. Bald war er wieder nach Wien zurückgekehrt, und weiter nach Währing gegangen, wo er in den frühen Morgenstunden ankam. In der Schulgasse verkaufte er den Ring.
In der Heiligenstädterstraße hatte er einem Erdarbeiter seinen grauen Überrock verkauft. Vom Erlös lies er sich bei einem Friseur die Haare schneiden und den Bart abrasieren. Weiter war er über Grinzing in den Dornbacher Wald geflüchtet. Es hatte ein heftiger Regen eingesetzt und mangels seines Überrocks war er bald völlig durchnässt und er hatte sich vorgenommen, in die Wohnung seiner Eltern zurückzukehren. Am Weg dorthin war er den beiden Wachmännern begegnet, die seiner Flucht ein Ende gesetzt hatten.
Gustav Allram legte sein Geständnis voller Emotionen ab, immer wieder unterbrach er sich durch heftiges Weinen und beteuerte immer wieder, dass er die Tat bereue. Er wiederholte mehrmals, in Steinhof gewesen zu sein und auch schon in Kierling behandelt worden zu sein.
Unter Beisein einer landesgerichtlichen Kommission nahm am 14. Mai Professor Dr. Kolisko die gerichtsmedizinische Obduktion vor. Der Befund: Tod durch Erwürgen.
Die Quartiergeberin des Mordopfers verständigte brieflich die Mutter vom Ableben der Tochter. Sie vermied es, die näheren Umstände des Ablebens zu erwähnen. Schon zwei Tage später schrieb die Schwester von Leopoldine nach Wien und bestätigte den Erhalt der traurigen Mitteilung. Sie bedauerte, weder sie selbst noch die Mutter könne zum Begräbnis nach Wien kommen. Für die alte Frau wäre die lange Reise zu anstrengend und sie selbst könne die Mutter nicht alleine lassen.
Am 16. Mai fand unter großer Beteiligung das Leichenbegängnis der Ermordeten statt. In der Kapelle des Allgemeinen Krankenhauses wurde die Einsegnung vorgenommen und danach der Sarg mit vielen Kränzen geschmückt auf den Zentralfriedhof gebracht.
Der Prozess
Am 1. November 1910 musste sich Gustav Allram seiner Tat wegen vor den Geschworenen verantworten. Den Vorsitz führte Landesgerichtsrat von Würth, die Anklage vertrat Staatsanwalt Dr. Budinski und Dr. Siegfried Türkel hatte die Verteidigung übernommen. Als gerichtsmedizinische Sachverständige waren der Leiter des Institutes Professor Dr. Albin Haberda und Dr. Reuter anwesend, über den Geisteszustand gaben die Psychiater Regierungsrat Professor Fritsch und Dozent Dr. Bischof ihre Gutachten ab. Die Verhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.
Die Einvernahme des Angeklagten hinsichtlich der Tatausführung brachte keine neuen Erkenntnisse. Mit Erstaunen wurde seine Aussage zur Kenntnis genommen, Piller sei sofort nach dem ersten Griff gegen ihren Hals bewusstlos zusammengebrochen. Professor Dr. Haberda lieferte dazu die Erklärung, Piller war von äußerst schwächlicher Konstitution und überdies von einer infektiösen Erkrankung befallen, sodass der Behauptung des Angeklagten Glauben zu schenken wäre.
Gustav Allram während der Gerichtsverhandlung.
1906 war Gustav Allram in psychiatrischer Behandlung. Es wurde bei ihm Jugendirrsinn festgestellt, der ihm jegliche Vernunft geraubt hatte. Die aktuelle Untersuchung seines Geisteszustandes brachte das Ergebnis, dass er vollkommen geheilt war und auch keine Spuren jedweder Geisteskrankheit vorlagen.
Allram schilderte die Ausführung der Tat, wie er sie bereits in seinen Einvernahmen vor der Polizei und dem Untersuchungsrichter gegeben hatte. Er wollte den Geschworenen glaubhaft machen, dass er das Opfer nur einige Sekunden gewürgt hätte und es daraufhin auch gleich gestorben wäre. Professor Dr. Haberda widerlegte dies in seiner Aussage, räumte zwar ein, dass eine sehr baldige Bewusstlosigkeit eingetreten sein mochte, doch musste dem Mädchen schon einige Minuten lang der Hals zugedrückt worden sein. Auf die Frage des Vorsitzenden sagte Professor Haberda, dass das Opfer sofort nach dem ersten Angriff gegen ihren Hals auch nicht mehr um Hilfe hatte rufen können, doch ergab sich dies ja bereits aus seiner Erklärung, dass sie sofort bewusstlos geworden sein könnte.
Die Gerichtspsychiater hielten den Angeklagten für geistig vollkommen gesund und auch für die Tat voll verantwortlich. Dr. Türkl stellte den Antrag auf Einholung eines Fakultätsgutachtens, dem am folgenden und letzten Tag des Verfahrens nicht stattgegeben wurde. Gegen Mittag des 19. November 1910 veröffentlichten die Geschworenen ihr Verdikt, demnach sie Gustav Allram einstimmig schuldig des Raubmordes an Leopoldine Piller erkannten. Die Zusatzfrage auf Sinnesverwirrung wurde einstimmig verneint. Den geltenden Bestimmungen zufolge wurde der 22-jährige Gustav Allram zum Tod durch den Strang verurteilt. Ohne Zeichen von Aufregung nahm er das Urteil vollkommen ruhig auf.
Am Vormittag des 23. März 1911 wurde dem Verurteilten die Begnadigung bekannt gegeben. Nach Begnadigung durch den Kaiser hatte der Oberste Gerichtshof die Todesstrafe in eine 20-jährige schwere Kerkerstrafe umgewandelt.
Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1910 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner) + Bildergänzung erichs-kriminalarchiv.com
7. Der Fall - Richard Henkel
Blutiges Geschmeide
Julius Frankfurter betrieb seinen Juwelierladen am Wiener Laurenzerberg im Zentrum der Stadt. Am 8. Dezember 1908 kam sein Sohn gegen Mittag in das Geschäft und fand seinen Vater regungslos hinter dem Verkaufspult liegen, um den Kopf eine ausgedehnte Blutlache.
Julius Frankfurter war tot. Zwei Ärzte, die zufällig in der Nähe des Juwelierladens waren, wollten dem Geschäftsmann helfen, doch es war zu spät. Sein Kopf wies eine Schusswunde auf und es kam der Verdacht eines Selbstmordes auf. Trotzdem keine Schusswaffe gefunden werden konnte, wollte man von dieser Theorie nicht abgehen. Augenscheinlich schien es auch, als fehlte nichts im Geschäft.
Die Waffe zu der das sichergestellte Projektil passte.
Nach der gerichtsmedizinischen Obduktion wurde die Version, dass sich Frankfurter die Schussverletzung selbst zugefügt hatte, ausgeschlossen. Das Projektil konnte sichergestellt werden und lieferte der Polizei wertvolle Hinweise. Waffen, in die solche Patronen passten, waren in Österreich nicht erhältlich. Auch die weiteren Erhebungen ergaben, dass man doch von einem Raubmord ausgehen musste. Die persönliche Brieftasche des Opfers fehlte, in der sich allerdings kein namhafter Betrag befunden hatte. Und es fehlten einige Schmuckstücke.
Es gab keine Zeugen
Die Erhebungen der Polizei schienen festgefahren, es waren keine Zeugen zu finden, die etwas gehört oder gar gesehen hatten. Das Geschäft selbst hatte sehr dicke Mauern und bei den durchgeführten Versuchen mussten die Ermittler zur Kenntnis nehmen, dass auch eine Waffendetonation im Nachbargeschäft nicht zu hören war. Somit konnte man den Tatzeitraum nur vermuten, bzw. durch die gerichtsmedizinische Begutachtung errechnen.
Ausländische Polizeibehörden wurden vom Raubmord an dem Juwelier verständigt und man sandte ihnen Abbildungen der fehlenden Schmuckstücke.
Der Juwelenladen von Julius Frankfurter.
Bald wiesen die Erhebungen auf einen internationalen Hochstapler, der sich in Wien aufhielt, einen Mann Namens Duidenius. Er war erst kurz vor der Tat nach Wien gekommen und hatte kein Alibi für den Zeitpunkt der Tat, auch passte die Verwendung einer ausländischen Waffe zu ihm. Er wollte offensichtlich überstürzt abreisen und hatte ein paar Schmuckstücke bei sich, über deren Herkunft er keine Angaben machen konnte. Zeugen wollten diese Schmuckstücke im Geschäft des Frankfurter gesehen haben. Duidenius legte kein Geständnis ab. Er sei nie im Geschäft dieses Juweliers gewesen, sagte er, die Schmuckstücke habe er einer wohlhabenden Frau in Italien gestohlen. Nur wisse er nun nicht mehr genau, wo in Italien das gewesen war, weil er über seine Raubzüge nicht Buch geführt hatte.
Der Raubmörder wollte seiner Freundin imponieren
Die Wiener Behörden betrachteten den Fall als abgeschlossen und verfassten einen Bericht an die Staatsanwaltschaft. Dann traf überraschend eine Nachricht aus Deutschland ein: Am 16. Dezember 1908 wurde in Berlin ein junger Mann beim Versuch Schmuckstücke in einer Pfandleihanstalt zu verkaufen, verhaftet. Die Beschreibungen der beim Juwelier Frankfurter gestohlenen Pretiosen passten auf die Juwelen, die der 22-jährige Richard Henkel zum Kauf angeboten hatte. Der junge Mann hatte den Raubmord in Wien bei der ersten Einvernahme zugegeben. Als Motiv gab er an, er hätte seiner Freundin mit Reichtum imponieren wollen. Er hätte ihr vorgegaukelt, wohlhabend zu sein und das hätte er ihr eben beweisen wollen.
Bericht in der Tagespresse über das Hinrichtungsprozedere.
Duidenius wurde aus der Haft entlassen und am 24. März 1909 musste sich Henkel seiner Tat wegen vor der Strafkammer des Landesgerichtes I in Berlin verantworten. Er bekannte sich schuldig und erklärte, seine Braut so sehr geliebt zu haben und ihretwegen sei er zum Mörder geworden. Vor Gericht schilderte er die Tat völlig ruhig, was man als gefühllose Brutalität erschüttert zur Kenntnis nahm.
Um die örtliche Situation leichter vorstellbar zu machen, fertigte die Wiener Polizei ein Modell (maßstabsgetreu) des Tatortes an. Das Modell war aus Holz, Karton und Glas und hatte eine Länge von cirka einem Meter. Es wurde detailgenau ausgearbeitet, sodass nicht nur die Farben genau zum Originalschauplatz passten, sondern sogar die Einrichtung des Geschäftes dargestellt wurde. Eine kleine Puppe ergänzte letztendlich den schaurigen Tatort, denn sie mußte die Position des ermordeten Juweliers einnehmen.
Am zweiten Verhandlungstag wurde die Freundin Henkels als Zeugin einvernommen, die der Angeklagte als seine Verlobte bezeichnet hatte. Sie wehrte sich aber vehement dagegen und bestand darauf, dass sie nur Bekannte waren. Sie waren niemals in engerer Beziehung gestanden, nicht einmal auf vertraulichem Fuße.
Als er nach Wien gefahren war, hatte er ihr gesagt, dass er zu seinen Eltern fahre, um sie zur Verlobungsfeier zu holen, das Festmahl wäre auch schon bestellt gewesen. Sie war damals auch sehr überrascht gewesen, weil er unerwartet von dieser Verlobung gesprochen hatte. Als er von Wien zurückkam, hatte er ihr eine goldene Uhr und zwei Ringe mit Brillanten geschenkt.
Das Todesurteil
Die Geschworenen bejahten die Schuldfragen einstimmig und Richard Henkel wurde zum Tode und zur Aberkennung der bürgerlichen Rechte verurteilt. Er wirkte sehr gefasst, als er die Worte des Richters vernahm. Der Verteidiger brachte ein Gnadengesuch an den König ein, doch dieses blieb ohne Erfolg.
Am Montag, dem 23. August 1909, traf die entsprechende Kabinettsorder beim Justizminister ein und Henkel wurde hievon umgehend informiert. Erst jetzt hatte er begriffen, was das für ihn bedeutete. Als er das Urteil vernommen hatte, war er sich einer Begnadigung sicher, doch nun wusste er, dass er verloren hatte. Weinend nahm er diese Entscheidung zur Kenntnis. In den letzten Tagen schien er erst wirklich begriffen zu haben, was er getan hatte. Er zeigte sich erstmals reumütig und schrieb Briefe an seine und die Verwandten des Opfers, in denen er um Verzeihung bat.
Die letzten Tage aß Henkel fast nichts mehr und weinte ununterbrochen. Kurz vor dem Hinrichtungstermin wurde er nach Plötzensee verlegt und in der Mörderzelle untergebracht. Außer dem Prediger Hirsch war niemand gekommen, um ihn zu besuchen. Am Nachmittag des 24. August kam gegen 5 Uhr der Scharfrichter Gröbler aus Magdeburg mit seinen Gehilfen und die Exekution im Hof des Gefängnisses wurde vorbereitet. Am Abend dieses Tages wurden dem Verurteilten die Fesseln abgenommen und er durfte die erste Nacht ohne Bewegungseinschränkung verbringen. Am Abend ließ er das Essen stehen und die Nacht verbrachte er großteils unruhig auf seinem Lager hin- und herwälzend.
„Das Urteil ist vollstreckt!“
Am Morgen des 25. August wurde er kurz vor 6 Uhr aus seiner Zelle geholt und über den großen Hof in einen kleinen Nebenhof geführt, in dem das Schafott errichtet worden war. Währenddessen läutete das Armensünderglöckchen und Henkel wirkte völlig teilnahmslos.
Auf dem Richtplatz erwarteten ihn bereits der Gerichtsvorsteher mit zwölf Zeugen und Gerichtsbeamten sowie einigen Polizeibeamten und der Scharfrichter mit seinen Gehilfen. Nachdem der Staatsanwalt das Urteil verlesen hatte, wurde Henkel dem Scharfrichter übergeben. Mit geübten Händen packten ihn die Gehilfen und schnallten ihn auf das Brett, das sofort nach vorne fiel und Scharfrichter Gröbler löste die Arretierung des Fallbeils. Darauf meldete er: „Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt!“
Ein schlichter schwarzer Holzsarg war schon bereitgestellt worden, in den der Körper und der Kopf gelegt wurden und in einem einspännigen Wagen brachte man den Leichnam des Hingerichteten zum vorbereiteten Grab auf dem Gefängnisfriedhof.
Um neun Uhr wurde die vollzogene Enthauptung an den Anschlagssäulen öffentlich bekannt gegeben.
Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1909 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner)
8. Der Fall - Anna Kubovsky
Anna Kubovsky war eine fürsorgliche Frau, sie pflegte alte und kranke Menschen, die sie in ihr Haus aufnahm. Dann sollte das Haus einen schaurigen Beinamen bekommen.
Das Wiener Sicherheitsbüro hatte Informationen erhalten, dass sich Josef Schaden, gegen den ein Aufenthaltsverbot bestand, oder wie es damals geheißen hatte, der aus Wien „abgeschafft“ werden sollte, im Hause Lerchenfelderstraße 66 unangemeldet aufhielt. Schaden war schon mehrmals wegen Einbruchdiebstahls vorbestraft und nun sollte seine Abschaffung vorgenommen werden. Kriminalbeamte begaben sich am 9. Juli 1909 an den angegebenen Ort. Sie trafen den Gesuchten an, der am Besuch der Ordnungshüter wenig Gefallen fand. Ein zweiter Mann befand sich auch noch in dem kleinen Raum. Er wies sich aus, sein Name war Methud Hlasny. Er gab an, eine Unterkunft im 2. Wiener Gemeindebezirk zu haben Hauptmieterin der Wohnung war Anna Kubovsky, Strickerin, 43 Jahre alt. Selbst auch kein unbeschriebenes Blatt. Schon vor 4 Jahren, genau am 22. März 1905 war sie wegen Kautionsschwindel angezeigt und zu zwei Jahren schweren Kerkers verurteilt worden.
Die Wiener Innenstadt um 1900 mit ihren Einkaufsstraßen
Hlasny erstattete nun Anzeige, von Kubovsky betrogen und bestohlen worden zu sein. Er hatte die Frau durch ein Inserat kennen gelernt, in dem sie sich als gut situierte, heiratswillige Witwe ausgegeben hatte. Ihm habe die Frau gefallen, ihre stattliche Erscheinung habe es ihm angetan. Sie habe ihm erzählt, in einer Pension zu leben, in der mehrere wohlhabende Damen lebten. Sie erzählte von einem beachtlichen Einkommen, das sie durch Sticken von Paramenten erziele, sie wollte sogar mehrere Mädchen beschäftigt haben, die für sie stickten. Kubovsky erzählte von ihrer Wohnung und lud den Mann auch gleich ein, alles anzuschauen. Hlasny nahm an und bewunderte die hübsch eingerichtete Wohnung, alles war ordentlich, einige Paramente lagen auf einem Tisch. Dazu erzählte die Witwe gleich verschiedene Geschichten, jedes Stück hätte eben seine eigene Geschichte und wäre nicht nur ein kirchliches Bekleidungsstück.
Kubovsky sorgt sich um Alte und Kranke
Sodann kam Hlasny zwei- bis dreimal in der Woche zu der schönen Witwe, die ihm einmal erzählte, dass die anderen Bewohner der Pension schon höheren Alters wären und allesamt auch schon sehr kränklich. Sie hatte ihm auch erzählt, bald aufs Land ziehen zu wollen, wo sie ein Landhaus mit schönem Garten kaufen wollte. Sie fragte Hlasny auch gleich, ob ihm das gefallen könnte. Hlasny war glücklich, diese wunderbare Frau kennen gelernt zu haben.
Wenn Hlasny das Gespräch auf das Vorleben der schönen Witwe zu lenken versuchte, verstand sie es jedes Mal geschickt, das Thema zu wechseln. Auch erst viel später kam es ihm verdächtig vor, dass sie ihn nie in die anderen Zimmer hatte schauen lassen.
Eines Tages kam Kubovsky zu Hlasny und erzählte ihm ganz aufgeregt und begeistert, einen Auftrag von der Stephanskirche zum Besticken wertvoller Paramente erhalten zu haben. Sie stellte einen großen Gewinn in Aussicht und sagte zu Hlasny: „In der Audienz bei Weihbischof Dr. Marschall war ich schon und es ist alles geregelt.“ Sie müsse sich jetzt in große Unkosten stürzen, die sich x-mal rechnen sollten. Sie überredete Hlasny, sich an dem Geschäft zu beteiligen. Er war bereit, ihr ein Darlehen in der Höhe von 1000 Kronen zu gewähren. Doch bald hatte er das Gefühl, dass ihre Liebe nachließ. Er schrieb das der vielen Arbeit zu, die auf sie zugekommen war. Bald kam sie wieder und behauptete, ein Klavier spottbillig kaufen zu können, das gut 800 Kronen wert sei, wofür sie aber nur 350 zahlen müsste. Doch nur gerade in diesen Tagen fehle es ihr an diesem Betrag. Hlasny war schon skeptisch geworden, ließ sich aber doch überreden und gab ihr ein Drittel des gewünschten Betrages.
Die Liebe der Kubovsky scheint zu erkalten. Von ihrer Liebe spürte er noch weniger und von einem Klavier war schon gar nichts zu sehen. Er wurde unruhig und sprach sie an, was denn mit der eingangs zugesagten Hochzeit wäre. Da vertröstete sie ihn wieder, sie müsste sich um die betagte Frau Murmann kümmern und da könnte sie in diesen Tagen nicht ans Heiraten denken. Er, Hlasny, könne aber schon damit beginnen, seine Sachen aus seiner Wohnung in die der Kubovsky zu bringen.
So geschah es dann auch und Kiste um Kiste wechselte die Unterkunft. Nur er selbst durfte bei der Witwe nicht einziehen, weil sie, wie sie behauptete, sich um die 84-jährige Dame kümmern müsse, die Kubovsky versprochen hätte, sie als Erbin einzusetzen.
Am 13. Mai 1909 starb Frau Murmann. Als Hlasny davon hörte, hoffte er auf Hochzeit und Rückzahlung. Doch musste er bald zu Kenntnis nehmen, dass von einer Erbschaft der Kubovsky keine Rede war. Angeblich hätte die alte Dame alles einem Verwandten vermacht. Da lud sie Hlasny ein, das Zimmer der Verstorbenen zu beziehen und er sollte dabei auch gleich sein restliches Mobiliar mitbringen. Hlasny hatte ihr einmal erzählt, dass er über besonders wertvolle Möbel verfügte. Der Mann willigte ein und die Übersiedlung war bald abgeschlossen.
Kurz darauf überredete ihn Kubovsky sie nach Pressburg zu begleiten, wo wertvolle Messkleider abzuholen wären, die von der Frau repariert werden sollten. Hlasny willigte ein und sie fuhren mit dem Nachmittagsdampfer nach Pressburg, wo sie gegen Abend ankamen. Kubovsky sagte, dass sie von einer Freundin am Bahnhof abgeholt werden sollten und beide gingen zum Bahnhof. Doch niemand erwartete sie. Da sie bei dieser Freundin übernachten sollten, schlug Kubovsky vor, einfach zu dieser Frau zu gehen. Hlasny stimmte zu und beide verließen den Bahnhof. Der Mann wunderte sich über die Richtung, in die sie gingen, denn sie entfernten sich immer mehr von den Häusern und kamen immer tiefer in die einsam gelegenen Donauauen.
Unheimlicher Spaziergang durch die Donauauen. Hlasny hatte das beängstigende Gefühl, dass sie schon seit geraumer Zeit von einem Mann verfolgt wurden. Immer wenn sich Hlasny umdrehte, sah er, wie sich der Fremde plötzlich versteckte. Rundherum war es finster, weit und breit kein Haus, wo auch nur irgendwer wohnen könnte. Vor ihm diese Frau, die ihm immer wieder Versprechungen machte und hinter ihnen dieser unheimliche Mensch.
Hlasny weigerte sich, weiter zu gehen und drängte auf Umkehr. Die Frau willigte nach längerem Hin und Her ein, bot ihrem ängstlichen Begleiter an, aus einer mitgebrachten Weinflasche zu trinken. Dankbar nahm er an, doch es kam ihm auch das schon wieder verdächtig vor und so nahm er nur einen kleinen Schluck, den er im Mund behalten wollte. Doch sofort machte sich ein widerlicher Geschmack bemerkbar und Hlasny spuckte aus. Er verlangte von Kubovsky, dass auch sie von dem Wein kostete, doch sie lehnte ab, sie trinke nie Wein und warf die Flasche in weitem Bogen weg.
Beide kamen nach Pressburg zurück und übernachteten in einer billigen Pension. Am nächsten Morgen schickte Kubovsky Hlasny weg, er solle sich Pressburg anschauen, während sie die Sache mit den Messkleidern erledigen wollte. Überraschend schnell war dieses Geschäft abgewickelt und für den Mann ging es endlich zurück nach Wien. Er war misstrauisch geworden und deutete dies deutlich an. Da hatte er doch schon mehrmals der Frau Geld geborgt und nie etwas von Rückzahlung gesehen und dann war da diese dubiose Fahrt nach Pressburg. Doch Kubovsky konnte ihn wieder zufrieden stimmen. Sie behauptete, von dieser verloren geglaubten Erbschaft nun doch noch 40.000 Kronen bekommen zu haben. Und Hlasny blieb.
Erst als er bemerkte, dass sein kürzlich zu ihm gezogener neuer Zimmergenosse ihm 500 Kronen aus dem versperrten Koffer gestohlen hatte, in dem er das Schloss aufgebrochen hatte und dann kam auch noch die Polizei, um diesen Mitbewohner abzuholen, erstattete er Anzeige gegen Anna Kubovsky.
Eine Anfrage in Pressburg ergab, dass dort niemand von Kubovsky und Messkleidern etwas wusste. Weder hatte dort wer einen Auftrag an irgendjemanden gegeben, noch war Kubovsky bei einem der in Pressburg ansässigen Pfarren erschienen. Also waren die Beamten geneigt, den Verdacht des Hlasny, dass ihn seine Unterkunftsgeberin in den Pressburger Donauauen umbringen wollte, ernsthaft zu betrachten. Sie unterzogen Kubovsky und ihr Umfeld einer genauen Überprüfung. Und was dort zum Vorschein kam, drohte manchen großen Wiener Kriminalfall in den Schatten stellen zu können. Waren doch innerhalb kürzester Zeit mehrere in Kubovskys Obhut, oder zumindest Unterkunft stehende Personen, auf - nachträglich betrachtet - zumindest auffällige Weise ums Leben gekommen. Wohl war jedes Mal ein natürlicher Tod bescheinigt worden, doch bei neuerlicher Befragung der zuständigen Ärzte schien das nun doch nicht ganz so einwandfrei gewesen zu sein.
Schwere Verdächtigungen gegen Anna Kubovsky
Angesichts dieser Vorfälle hielt man es schon für möglich, dass Kubovsky Hlasny in die Donauauen gelockt hatte, um ihn dort zu töten. Sie hätte sich der Rückzahlung des von ihm gewährten Darlehens entledigen und das Eigentum des Mannes an sich nehmen können. Die Erhebungen liefen an und schon tauchten weitere verdächtige Todesfälle im Hause Lerchenfelderstraße 66 auf. Kurz hintereinander waren drei Aftermieter der Kubovsky plötzlich verstorben: Am 12. Juni 1908 der 56-jährige Edmund Becker von Dornfeld. Am 1. November desselben Jahres des 35-jährige Ferdinand Reingruber, der als Pretiosenagent oft erhebliche Werte mit sich geführt hatte, und letztendlich am 13. Mai 1909 Marie Murmann, die sich schon im Greisenalter befunden hatte. Von ihr wusste man, dass sie sehr vermögend war, doch nun war von diesem Geld nichts zu finden.
Anna Kubovsky konnte bei Aufkommen dieser neuen Verdächtigungen auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Als junge Frau hatte sie in weitem Umkreis als fesche Erscheinung gegolten. 1887 hatte sie in Klagenfurt geheiratet, es mit der Treue aber nicht sehr genau genommen und eines Tages hatte sie ihr Gatte in den Armen ihres Liebhabers ertappt. Der gehörnte Ehemann hatte einen Hirschfänger ergriffen und auf den Kontrahenten eingestochen, der den Ort des Geschehens nicht mehr lebend verlassen konnte. Der betrogene Gatte wurde wegen Totschlages angeklagt, von den Geschworenen in der Folge freigesprochen. Bald danach war auf sein Drängen die Scheidung erfolgt und Kubovsky war nach Wien gezogen, wo sie rasch in den Armen junger und älterer Männer Trost finden konnte. Hinsichtlich des Alters hatte sie es nicht so genau genommen, nur eine Vorraussetzung musste der Liebhaber mitbringen: er musste vermögend sein und von der Barschaft musste auch für sie etwas abfallen. Die älteren Herren hatten sich zumeist zu Lebzeiten uneingeschränkt an ihrem Vermögen erfreuen können, sie hatten Kubovsky nur im Testament entsprechend berücksichtigen müssen.
Reiche Erbschaft
Die ersten Probleme kamen auf Kubovsky zu, als sie den betagten und kränklichen, vor allem aber auch vermögenden Gottfried Eberle aufgenommen hatte. Eines Tages bedachte er die Frau mit einem bedeutenden Vermögensanteil in seinem Testament. Am 2. Februar 1903 starb der Mann und Kubovsky erhielt eine beträchtliche Summe. Dann traten die gesetzlichen Erben auf und erstatteten Anzeige gegen die Frau, die den alten Eberl vor seinem Hinscheiden gepflegt hatte, mit dem Inhalt, Kubovsky hätte das Vermögen des Mannes beiseite geschafft und sich angeeignet.
Das Verfahren war noch im Laufen, als eine zweite Anzeige bei Gericht einlangte. Wieder waren die Kläger gesetzliche Erben eines Verblichenen. Und zwar des am 19. Oktober 1903 in der Wohnung der Kubovsky verstorbenen Bernhard Kohatny. Es handelte sich wiederum um einen Mann, der den Zenit des Lebens bereits überschrittenen hatte, der bei Kubovsky eingezogen und von ihr gepflegt worden war. Ob der hervorragenden Obsorge hatte er sie eines Tages in seinem Testament berücksichtigt. Und dann kam es, wie es kommen musste: Der alte Mann starb und Kubovsky erbte. Als die Verwandten davon hörten, gingen sie zu Gericht.
Kubovsky sollte sich nicht nur in die Testamente geschlichen, sondern schon vorher Barschaften zur Seite geschafft haben und überdies wurde ihr vorgeworfen, beim Ableben der alten Herren nachgeholfen zu haben.
Die Erhebungen konnten nicht nachweisen, dass Kubovsky sich irgendwelcher Schwindel hinsichtlich der Testamente zu schulden kommen hatte lassen. Ihr konnte nicht nachgewiesen werden, in irgendeiner rechtswidrigen Form das Vermögen des einen oder des anderen Greises angegriffen zu haben. Es konnte ihr genauso wenig nachgewiesen werden, beim Tod des einen oder des anderen nachgeholfen zu haben. Aufgrund der intimen Beziehung zu den Herren konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie schon zu Lebzeiten Kubovsky mit Geldgeschenken bedacht und ihr Testament entsprechend ergänzt, bzw. geändert hatten. Auch fanden sich keine Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod.
Die Mörderhöhle am Lerchenfeldergürtel
So wurde es vorübergehend still um die Frau und erst wieder 1909 wurden die alten Todesfälle aufgerollt und das Haus wurde von den Wienern „die Mörderhöhle am Lerchenfeldergürtel“ genannt. Es waren einfach zu viele, die in kurzer Zeit hintereinander in diesem Haus gestorben waren. Nicht nur in diesem Haus, sondern im selben Zimmer und immer unter der Pflege der Anna Kubovsky. Nun wollte sich ein anderer Mieter des Hauses auch daran erinnern, dass er kurz vor dem Tod der Marie Murmann von Kubovsky um Hilfe ersucht worden war, weil der alten Frau unwohl geworden war und sie vor dem Bett gestürzt war. Der Mieter hatte geholfen, Murmann ins Bett zu legen. Beim Verlassen der Wohnung wollte er Gasgeruch wahrgenommen haben und hatte daher die Fenster geöffnet. Wenige Tage nach diesem Zwischenfall war Murmann verstorben. Im Totenschein war unter Todesursache Halsentzündung eingetragen.
Vor Gericht
Kubovsky erklärte, dass die alte Murmann schon sehr vergesslich gewesen war und immer die Ofentür geöffnet hatte, sodass es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung gekommen war, aus der in der Folge die tödliche Halsentzündung geworden war. Vorwürfe gegen die Ärzte, die die Totenbeschau vorgenommen hatten wurden laut, zugleich dachte man als Entschuldigung an die im Greisenalter verstorbenen Menschen, die schwer krank waren und daher ein natürlicher Tod eher anzunehmen war. Oberbezirksarzt Dr. Klaar wurde befragt und er erinnerte sich an den Patienten Becker von Dornfeld, den er von einem Kollegen übernommen hatte und wie schon sein Vorgänger heftige Ischiasbeschwerden diagnostiziert hatte. Die Behandlung wurde in Abstimmung mit einem Nervenspezialisten vorgenommen, dennoch verschlechterte sich der Zustand des Mannes. Dr. Klaar veranlasste die Einweisung in eine Klinik, wo der Mann nach zwei Tagen starb. Unter all diesen Voraussetzungen hätte damals niemand den Verdacht auf eine nicht natürliche Todesursache ernst genommen. Auch war ihm Frau Kubovsky als äußerst fürsorglich aufgefallen, die sich in selbstloser Weise dem Patienten zu widmen schien.
Dr. Klaar war auch der behandelnde Arzt der Frau Murmann. Eines Tages war er zu ihr gerufen worden, weil sie sich unwohl gefühlt hatte. Es war jener Tag, an dem ein zur Hilfe gerufener Mieter Gasgeruch wahrgenommen haben wollte. Der Arzt konnte sich nicht erinnern, irgendetwas Auffälliges gerochen zu haben, weil er sonst sofort darauf reagiert hätte. Wohl erinnerte er sich, dass das Fenster offen gestanden war und es in der Wohnung kalt gewesen war. Da die Patienten stark gefiebert hatte, hatte er angeordnet, das Fenster zu schließen. Als Diagnose hatte er in seinen Aufzeichnungen vermerkt: Bronchitis mit alten Veränderungen an den großen Gefäßen des Herzens. Tags darauf hatte er sie wieder besucht und sie hatte sich besser gefühlt und war sogar zum Scherzen aufgelegt. Am nächsten Tag war Frau Murmann tot. Für Dr. Klaar war das damals kein Grund, einen Verdacht zu schöpfen. Eine alte kranke Frau mit diesen Vorbeschwerden konnte an einer ausgebreiteten Bronchitis schon sterben, so hatte er auch bedenkenlos den Behandlungsschein ausgestellt, der zu einer Freigabe bei der Totenbeschau geführt hatte.
Statt Rückzahlung Kost und Quartier angeboten.
Gegen Anna Kubovsky wurde ein Hatftbefehl ausgestellund eine Hausdurchsuchung angeordnet. Eine große Zahl an Rezepten und verschiedenen Fläschchen mit verdächtigem Inhalt wurden sichergestellt und dem Gerichtschemiker zur Untersuchung übergeben.
Nach und nach trafen beim Sicherheitsbüro neue Anzeigen gegen Kubovsky ein. Mieter wollten verdächtigen Geruch festgestellt haben, sie vermuteten, Leichengeruch. Eine Untersuchung aller in Frage kommender Bereiche, inklusive des Kanals brachte aber kein Ergebnis.
Von Gabriele Schlesinger hatte Kubovsky 1400 Kronen unter der Vorspiegelung, an einem lukrativen Paramentengeschäft verdienen zu können, herausgelockt. Als Schlesinger nach längerer Zeit nichts von ihrem Geld gesehen und die Kubovsky darauf angesprochen hatte, hatte ihr Kubovsky Kost und Quartier angeboten, um so das geliehene Geld zurück zu zahlen. Schlesinger akzeptierte. Eines Tages hatte die Suppe einen widerlichen Beigeschmack und als sie das erwähnte, hatte Kubovsky die ganze Terrine ausgeschüttet, ohne davon zu kosten. Bald darauf war Schlesinger ausgezogen und hatte keinen Kontakt mehr mit der Verdächtigen.
Der Arzt Dr. Ritter von Glowacki, der den unter Obhut der Kubovsky stehenden Reingruber behandelt hatte, gab an, dass er seinerzeit von Kubovsky gerufen worden war, weil einem bei ihr lebenden Mieter übel geworden war. Unmittelbar danach war der Arzt in der Wohnung der Hilfesuchenden eingetroffen und hatte Reingruber im Bett angetroffen. Der Patient hatte keine Lebenszeichen mehr und dem Arzt war aufgefallen, dass der Körper schon ganz kalt war. Nicht nur die Arme und Beine, beim Abhören des Herzens hatte sich auch der Körper erkaltet angefühlt. Daraus hatte der Arzt geschlossen, dass der Mann schon länger tot gewesen sein musste, als aufgrund der Angaben der Kubovsky anzunehmen war. Die Frau hatte sich aber wie wild gebärdet und alle möglichen Medikamente herbeigeholt, die sie nach Anweisung des Hausarztes dem Manne gegeben hatte. Dr. Ritter von Glowacki hatte ihr danach gesagt, dass der Totenbeschauarzt zu verständigen wäre und ihr noch geraten, sich wegen des Behandlungsscheines an den behandelten Arzt zu wenden. Beim Weggehen hatte er sich umgedreht und noch einmal zur Wohnung der Kubovsky hinaufgeblickt. Ihm war es vorgekommen, als wäre hinter der Frau noch ein Mann gestanden, der zuvor in der Wohnung nicht zu sehen gewesen war. Der Arzt hätte nur noch aus diesem Haus weg wollen, das ihm unheimlich erschienen war.
Die Erhebungen liefen auf vollen Touren
Die Gerichtschemiker bekamen laufend neues Untersuchungsmaterial. Alle Informationen zeigten, dass Kubovsky ein gigantisches Lügengebilde aufgebaut hatte, aus dem sie reichlich Gewinn ziehen konnte. Nun zeigte sich, dass alles erfunden war. In Pressburg hatte sie keine Freundin, niemand hatte vor, Geschäfte mit Paramenten mit Kubovsky zu machen. Das Hotel, in dem sie genächtigt haben wollte, als sie einmal alleine zu Informationszwecken nach Pressburg gefahren war, hatte es gar nicht gegeben. Die Erhebungen gegen Kubovsky liefen wegen fünffachem Mordverdacht.
Doch in den Fläschchen war kein Gift zu finden. Exhumierungen wurden angeordnet und in den Leichen konnte kein Gift festgestellt werden. Die Totenscheine und alle auffindbaren Befunde, der in ihrer Obhut stehenden Menschen wurden ausgehoben, doch in keinem Fall konnte der Kubovsky nachgewiesen werden, nachgeholfen zu haben. Bronchitis, Krebs mit Metastasen und Herzerweiterung waren als natürliche Todesursache zu betrachten. Als Kubovsky am 31. März vor Gericht stand, musste sie sich nur noch wegen mehrfachen Betruges verantworten. Ihr Verteidiger Dr. Rechert erwähnte noch, dass keiner der Mieter an der Krankheit, die „Kubovsky“ geheißen hatte, gestorben war.
Am 1. April hielten Staatsanwalt und Verteidiger ihre Schlussplädoyers. Dr. Rechert nutzte das Tagesdatum und machte sich über die Polizei lustig: „Wenn ein gewöhnlicher Mann, zum Beispiel ein Bäcker, ein Jubiläum feiert, macht er ein Riesenbrezel, ein Selcher eine Riesenwurst. Voriges Jahr hat die Sicherheitswache ihr vierzigjähriges Jubiläum gefeiert, dafür wollten sie ihren Riesenmord haben.“
Unter dem Gelächter der Zuhörer zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und kehrten nach zwei Stunden mit dem Verdikt zurück: Schuldsprüche wegen Veruntreuung und Betrug.
Anna Kubovsky wurde zu zweieinhalb Jahren schweren Kerkers verurteilt. Sie nahm die Strafe ruhig entgegen.
Die Lerchenfelder Straße mit ihren hohen Wohnhäusern.
In der Lerchenfelder Straße 66 befindet sich heute ein nobles Restaurant.
Quellen: - Illustrierte Kronen Zeitung, 1910 - Österreichische Nationalbibliothek - (von Erich Müllner) + Text- und Bildergänzungen durch erichs-kriminalarchiv.com
9. Der Fall - Josef Weinmann
Am Samstag, den 23. Mai 1908, wurde in Straubing (Königreich Bayern) der 36 Jahre alte Tagelöhner Josef Weinmann aus Weißensulz in Böhmen durch die Guillotine enthauptet. Am 21. November 1906 hatte man in einem Waldesdickicht bei Mießburg die Leiche einer erdrosselten Frau gefunden. Sie wurde als die der 32jährigen Agnes Lindenberger aus Springerstein in Oberösterreich identifiziert, zu der Weinmann früher ein Liebesverhältnis gehabt hatte.
Die beiden waren von Bewohnern der Umgebung in der Nähe des Tatortes gesehen worden, zuletzt am 23. September 1906. Erst ein Jahr später konnte Weinmann verhaftet werden. Nach anfänglichem Leugnen gestand er am 13. Februar 1908, seine ehemalige Geliebte erdrosselt und beraubt zu haben. Das Schwurgericht in Straubing verurteilte ihn am 10. April 1908 zum Tode. Nachdem Prinz-Regent Luitpold auf sein Gnadenrecht verzichtet hatte, wurde Josef Weinmann am 23. Mai 1908 um 6 Uhr auf dem Hofe des Landgerichtsgefängnisses in Straubing durch Scharfrichter Franz-Xaver Reichhart mit der Guillotine enthauptet.
Quelle:- todesstrafen.de
10. Der Fall - Vera Renczi
Trotz der enorm hohen Zahl von 35 Morden sind wenig Daten über die rumänische Serienmörderin bekannt.
Ihr genaues Geburtsdatum ist immer noch ein Rätsel, denn obwohl einerseits gesagt wird, dass sie 1903 in der Stadt Bukarest geboren wurde, deuten andere darauf hin, dass sie schon Ende des 19. Jahrhunderts auf die Welt gekommen sein könnte. Es existieren keine zuverlässigen Dokumente mehr, die ihr Geburtsdatum bestätigen. Als belegt gilt - Vera Renczi wurde als Kind wohlhabender Eltern in Bukarest geboren.
Bereits im Alter von 10 Jahren, als ihre Familie nach Berkerekul (dem heutigen Zrenjanin) zog, zeigte sie frühreifes Interesse an Sex. Mit 15 Jahren fand man sie um Mitternacht im Schlafsaal einer Jungenschule. Ab diesem Zeitpunkt riss sie mit verschiedenen Liebhabern von daheim aus und kam erst dann wieder zurück, wenn deren Aufmerksamkeiten sie langweilten.
Vera Renczi
Als Kind verlor sie ihre Mutter und zog zu ihrem Vater in die Umgegend von Berkerekul (heutiges Zrenjanin ), da auch ihr Onkel gestorben war und sie nun sein Herrenhaus am Rande der serbischen Stadt erben würden.
Zu all dem wurde Vera in ein Internat geschickt, bis sie das Alter der Volljährigkeit erreichte, aber ihr widerspenstiger Charakter veranlasste sie oft, das Internat heimlich zu verlassen und verschiedene Freunde zu besuchen, viele von ihnen ältere. Tatsächlich argumentierten einige Leute, die sie kannten, dass Vera eine Frau mit einer krankhaften Anziehungskraft auf Männer und ziemlich eifersüchtig sei. Vera konnte ihre Geliebten jederzeit verlassen, aber wehe jemand versuchte den Spieß umzudrehen, denn sie war krankhaft besitzergreifend!
Mit 16 Jahren heiratete sie zum ersten Mal einen wohlhabenden österreichischen Geschäftsmann namens Karl Schick, der mehrere Jahre älter war als sie, und mit dem sie ihren Sohn Lorenzo bekam. Sie zogen in ein Weinanbaugebiet, wo sie eine sehr erfolgreiche Weinkellerei gründeten.
Das Ehepaar - Vera Renczi (ihr Geburtsname ist nicht bekannt und ob sie sich während der Ehe mit Karl Schick - Vera Schick nannte, geht aus den Akten nicht hervor) und Karl Schick.
Alles deutet darauf hin, dass die Beiden ihr gemeinsames Glück gefunden hatten; doch Veras Eifersucht blieb ungebrochen. Die langen Reisen ihres Bankiers-Ehemanns ließen sie glauben, dass er sie ständig mit anderen Frauen betrog. Eines Nachts im Jahr 1920, als sie in der Villa zu Abend aßen, vergiftete sie den Wein ihres Mannes mit Arsen. Von einem Tag auf den nächsten war er plötzlich spurlos verschwunden. Er starb und ihr Alibi bestand darin, ihrer Familie und ihren Freunden plausibel mitzuteilen, dass ihr Mann sie verlassen hatte. Ein Jahr lang trauerte "die Verlassene" um ihren Gatten, der ihren Angaben nach ohne Erklärung gegangen war, bis sie (ein Jahr später) schließlich von „Neuigkeiten“ berichten konnte. Nun wurde die Lüge weiter ausgeweitet. Sie erzählte allen, dass sie die Information hatte, dass ihr Mann zusammen mit ihrem Sohn (den sie einige Zeit später vergiftet hatte) bei einem Unfall an der französischen Côte d'Azur ums Leben gekommen war. Beweisen mußte sie es nie und niemand hat je nachgeforscht.
Bereits verwitwet und einsam lernte sie den zwei Jahre älteren und ebenfalls solventen Geschäftsmann Josef Renczi kennen , obwohl diese Beziehung auch nur zwei Jahre währte. Der Geschäftsmann war ganz offenkundig untreu und schließlich nach ein paar Monaten - laut Veras Angaben - auf „eine lange Dienstreise“ entschwunden. Nach einem weiteren Jahr verkündete sie, dass ihr zweiter Ehemann ihr in einem Brief geschrieben habe, er wolle sie für immer verlassen.
Nach dieser Episode wurde Vera eine "mysteriöse Männerjägerin", da ihre Vorgehensweise wie folgt war: Sie besuchte nachts Cafés und Nachtclubs, traf Männer, die selten an diesem Ort zu sehen waren, und brachte sie zu ihrer Villa, wo sie ihnen ein Bankett gab - Lebensmittel und vergifteten Wein -. Danach bewahrte sie die Leichen im Keller auf.
Vera Renczi heiratete zwar nicht mehr, doch sie hatte im Laufe der Jahre noch viele Liebhaber, insgesamt 32. Dieses schienen nie lange bei ihr auszuharren, und keiner wurde je wieder gesehen, nachdem er Vera „verlassen“ hatte. Sie hatte aber stets eine Erklärung für die Nachbarn - und einen neuen Liebhaber, der hinter den Kulissen wartete.
Für die Serienmörderin schien alles perfekt zu laufen, bis eine betrogene Frau den Schlüssel zum Rätsel lieferte: Die Frau eines Bankiers hatte die Abenteuer des Mannes schon lange geahnt, beschloss, ihm in die Bar zu folgen und sah, wie ihr Mann kurze Zeit später gemeinsam mit Vera in deren Villa verschwand.
Die Zeit verging und da sie tagelang nichts über ihren Mann wusste, beschloss sie, zur Polizei zu gehen, die mit einer gerichtlichen Genehmigung zu dem riesigen Herrenhaus ging, das die Mörderin bewohnte. Der Ort war so groß, dass die Truppen durch lange steingewölbte Korridore und durch drei Eisentore gehen mussten. Als sie in die Kellerräume hinabstiegen, wo sich unter anderem ein Keller voller erlesener Weine befand, traf die Polizei das blanke Entsetzen: 35 Zinksärge, jeder aufgereiht mit dem Namen und dem Alter des Verstorbenen. In diesem Moment wurde Vera festgenommen und einem Richter vorgeführt, der beschuldigt wurde, den Bankier und andere Männer getötet zu haben.
Das Herrenhaus von Vera Renczi in der Nähe von Becicherec - heute Zrenianinului.
Die Untersuchung ergab, dass die Opfer der "schwarzen Witwe" 35 waren, darunter ihre beiden Ehemänner, ihr Sohn und die gesamten Liebhaber.
Der überwältigende Beweis aber war die Entdeckung von Arsen im Keller, ein Gift, das auch in kleinster Dosierung 100 Menschen töten kann und im ehemaligen Jugoslawien weit verbreitet war.
Vera wurde wegen Mordes festgenommen und gestand, ihre Männer mit Arsen ermordet zu haben, wenn diese sich anderen Frauen zuwandten. Manchmal hatte sie noch ein romantisches „letztes Mahl“ als Höhepunkt des Rendezvous zubereitet. Das Ableben ihres Sohnes hatte andere Ursachen: Er hatte mit Erpressung gedroht, als er zufällig die Gruft im Keller entdeckt hatte.
An manchen Abenden saß Vera auf einem Lehnstuhl zwischen den Särgen und erfreute sich der Gesellschaft ihrer sie anbetenden Männer.
Vera bestritt zunächst die Vorwürfe, gestand dann aber die Morde. Den Bezug der Verbrechen gegenüber den Männern begründete sie damit, dass „sie die Vorstellung nicht habe ertragen könne, dass sie andere Frauen umarmen könnten, nachdem sie es mit ihr getan hätten“, und in Bezug auf den Tod ihres Sohnes, sagte sie dem Richter, sie habe es getan, "weil er ein Mann war und eine andere Frau in seine Armen nehmen würde".
Im Prozess wurde sie der 35 Todesfälle für schuldig befunden. Aufgrund ihres eigenen Geständnisses wurde die Giftmörderin erst zum Tode verurteilt, später wurde das Urteil aufgehoben und in lebenslange Haftstrafe umgewandelt, da die Zugehörigkeit zum Adel sie vor der Todesstrafe bewahrte, weshalb die „Demütigung“ der Hinrichtung in die der ewigen Einsperrung umgewandelt wurde .
Letztendlich starb Vera Renczi 1960 im Gefängnis eines natürlichen Todes, und niemand beanspruchte ihren Körper.
Quellen: Die große Enzyklopädie der Serienmörder (von Michael Newton), 2. Auflage 2005 - S. 334 - ISBN 3-85365-189-5 + Text- und Bildergänzungen durch erichs-kriminalarchiv.com
11. Der Fall - Friedrich Schumann
Anfang Juli 1920 begann der Prozeß vor dem Schwurgericht des Landgerichtes 3 in Berlin-Moabit gegen einen der ersten Serienmörder im Zwanzigsten Jahrhundert in der deutschen Kriminalgeschichte. Der Begriff Serienmörder war seinerzeit noch nicht geboren, man sprach erstmalig von Mord in Serie und war damit nicht mehr weit entfernt von der heute gebräuchlichen Bezeichnung.
Die Anklage lautete: Mord in 7 Fällen, Mordversuch in 15 Fällen, 5 Brandstiftungen mit Tötungsabsicht, Notzucht in 11 Fällen und mehrfacher schwerer Diebstahl, 3 Raubüberfälle und Einbrüche. Insgesamt waren es 54 Anklagepunkte (Angaben aus Stadtarchiv Potsdam vom 14. Mai 1924).
Die schweren Verbrechen geschahen zwischen 1914 bis 1920. Den wirklich ersten Mord beging der Angeklagte im Dezember 1911 und wurde seinerzeit als fahrlässige Tötung vom Gericht bewertet und mit 9 Monaten Gefängnis geahndet, die auch verbüßt wurde.
5 Monate Untersuchungshaft hatte der Richter von der Gesamtstrafe abgezogen.
Die Tat war folgende: Schumann trieb sich, Einzelgänger, der er war, gern in der Nähe von Falkenhagen, nordwestlich von Berlin gelegen, herum. Gegen Abend erspähte er auf einer Chaussee eine Frau, der er sich in den Weg stellte. Schumann zückte seine Selbstladepistole und drückte ab. Die Frau war sofort tot und der Wochenlohn, den die Erschossene bei sich trug, wechselte den Besitzer. Doch man konnte ihn ergreifen, übersah aber seine Beute.
Vor Gericht gab er an, er hätte die Frau aus Versehen erschossen, als er mit der Waffe hantierte. Fatalerweise glaubte man ihm und so wurde ein glatter Raubmord als fahrlässige Tötung gewertet.
Doch dieses feige Verbrechen war erst die „Generalprobe“ für die zahlreichen, noch zu schildernden Morde, die eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte.
Doch zunächst, wer war Friedrich Schumann?
Friedrich Schumann kurz nach seiner Verhaftung.
Am 1. Februar 1893 wurde er in Berlin Spandau geboren. Sein Vater, wie auch sein Großvater waren ausgesprochene Trinker von alkoholischen Getränken aller Art. Friedrich Schumann hatte zeitlebens damit keine Probleme.
Sein Vater war vorbestraft wegen verschiedener Notzuchtverbrechen an Kindern, Betrügereien und Diebstahl. Immer wieder folgten Aufenthalte in Gefängnissen.
Schumanns Mutter hingegen war wie seine Schwester streng religiös und Mitglied der Mormonen, die seinerzeit als Sekte angesehen wurde.
Der Junge lernte Schlosser bei einem Berliner Großbetrieb (Gasanstalt) vom April 1907 bis 1910 und erhielt ein gutes Zeugnis. Er galt als verläßlich und fleißig.
Seine Kindheits- und Jugendzeit, so wurde überliefert, war außerordentlich bescheiden und trübe. Doch dies war bei den damaligen weitverbreiteten wirtschaftlichen Verhältnissen eher die Regel als die Ausnahme. Es kann vermutet werden, daß in dieser Zeit der Grundstein für seine späteren Taten gelegt wurde. Wutkrämpfe und Anzeichen offener Epilepsie wollte man bei ihm beobachtet haben.
Nach seiner Lehre wurde er am 6. Februar 1916 zum Militär gezogen und mußte, tausender Soldaten gleich, in den Ersten Weltkrieg. Er kämpfte unter anderem auch in Flandern. Hier lernte Friedrich Schumann treffsicher zu schießen. Es wurde seine Leidenschaft und später sein Verhängnis.
(Beispielfoto)
Er diente in mehreren Truppenteilen und mußte wegen Verletzungen einige Male Lazarette aufsuchen. Kommt gelegentlich auf Heimaturlaub nach Hause zurück. Für den mittlerweile guten Schützen erhält er das eiserne Kreuz. Trotzdem desertierte er und die Polizei suchte ihn im Raum Mainz wegen gefährlicher Körperverletzung.
Ihm wurde angelastet, eine Frau auf einer Chaussee überfallen und versucht haben, sie im Chausseegraben anschließend zu vergewaltigen. Damit das Opfer ihn nicht wiedererkennt, hätte er ihr den Rock auf das Gesicht gepreßt, ein Messer gezogen und dreimal zugestochen. Die hilflose Frau habe daraufhin ihren Widerstand aufgegeben. Doch dann fehlte dem Täter plötzlich die Potenz und er ließ von ihr ab. Das Drama soll cirka eine halbe Stunde gedauert haben. Schumann konnte vorerst aber nicht aufgespürt werden.
Gemäß amtlicher Unterlagen kehrte er unbehelligt am 27. November 1918 nach Berlin Spandau in die Staakener Straße 6 zurück und heiratete bald darauf.
Am 19. August 1919 meldete erstmalig die Abendausgabe des Berliner Tageblattes „Die Massenmorde am Falkenhagener See“, daß seit drei Jahren ein allem Anschein nach geisteskranker Mann umherstreife und vermutlich fünf bisher unaufgeklärte Morde zu verantworten habe. Am Vortag sei in unmittelbarer Nähe des Falkenhagener See gegen acht Uhr abends der 52-jährige Hilfsförster Franz Nilbock, verheiratet und Vater von drei Kindern, durch zwei Schüsse schwer verletzt worden. Wenig später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen gestorben.
Kurz nach dem Angriff auf den Förster sei dieser gefunden worden und konnte auf dem Weg in das Krankenhaus noch Aussagen: “Der Schütze hatte eine Armeeuniform sowie eine Schirmmütze getragen und mit einer Parabellumpistole (Doppel-laufwaffe) auf mich geschossen“. Der Schütze sei ca., 25 Jahre alt und Nilbock hätte ihn zuerst für einen Wilderer gehalten und ihn angerufen, wo er denn hin wolle. Als Antwort schoß der unbekannte Schütze zweimal mal, der dritte Schuß versagte. Der Förster war schwer getroffen, aber noch in der Lage mit Schrot zurückzuschießen und den flüchtenden Mann auch an der Schulter zu treffen. Danach sei der Unbekannte in der Dunkelheit verschwunden und Nilbock zusammengesunken.
Die Polizei hatte darauf den Wald mit Polizeihunden nach Spuren abgesucht, weil der Täter als der langgesuchte „Geisteskranke in Soldatenuniform“ vermutet wurde.
So meldete am Mittwoch, den 20. August 1919 das Berliner Tageblatt, daß die Kripo annimmt, der gesuchte Täter vom Vortag hätte vermutlich auch vor einigen Tagen auf der Schönwalder Chaussee bei Spandau den Arbeiter Lemm ermordet. Die zwei tödlichen Schüsse gegen Lemm waren aus einer Parabellumpistole des Kalibers 9 Millimeter abgefeuert worden. Die Obduktion der Leiche des ermordeten Förster Nilbock hatte nun ergeben, daß auch der Förster durch zwei Schüsse aus einer gleichen Waffe getötet worden ist. Dazu kam noch, daß die Personenbeschreibung des Täters genau mit der des Mörders von Lemm übereinstimmte.
In allen Berliner Tageszeitungen wurde darüber berichtet und Arztpraxen, Krankenhäuser waren sensibilisiert. Gesucht wurde ein Mann mit Schußverletzungen durch Schrotmunition.
Auch der Arzt Dr. Teffling in der Potsdamer Straße 42 in Spandau hatte in der Presse die Geschehnisse verfolgt.
Das Berliner Tageblatt vom 20. August 1919 veröffentlichte unter der Überschrift „Verhaftung des Massenmörders von Falkenhagen. Verräterische Schrotschußwunden,“ folgende Meldung:
"Der Massenmörder von Falkenhagen, der zuletzt den Förster Nilbock erschossen hat, ist heute verhaftet worden. Heute Vormittag gegen 11 Uhr kam ein Mann in die Sprechstunde des Arztes Teffling, Potsdamer Straße 42 zu Spandau, der eine zerrissene Uniform trug und eine Wunde am Hinterkörper hatte. Dem Arzt fiel das Benehmen des Mannes auf. Er ließ ihn in sein Verbandszimmer eintreten und benachrichtigte heimlich die Kriminalpolizei.
Auf die Frage des Arztes, woher die Verletzung stammte, gab der Verwundete an, daß er bei den Notstandsarbeiten der Straßenbahn beschäftigt sei und dort von den Splittern einer Sprengpatrone verletzt wurde. Die Kriminalbeamten sagten dem Verletzten auf den Kopf zu, daß er der gesuchte Massenmörder aus dem Falkenhagener Forst sei. Der Mann leugnete nicht und gab nur verworrene Antworten. Er schien ganz gebrochen zu sein. Es ist, soweit bisher festgestellt werden konnte, ein Arbeiter Schumann aus der Staakener Straße 6 in Spandau. Der Arzt stellte fest, daß in der Wunde des Verletzten sich noch Schrotkörner befanden, die von dem Schuß, den der ermordete Förster Nilbock auf den fliehenden Mörder abgegeben hatte, herrühren dürften."
Der festgenommene Schumann wurde zunächst zur Polizeiwache Spandau gebracht, am 21. August 1919 erkennungsdienstlich behandelt (s. Merkblatt) und anschließend von Kriminaloberwachtmeister Lahmann vernommen.
Vor ihm saß ein mittelgroßer, schmächtiger junger Mann mit auffallend unschön vorgeschobener Kinnpartie. Der Oberkiefer mit trotzigen geschlossenen Lippen wich stark zurück. Graublaue Augen mit stechendem Blick, die Stirn fliehend, so ein Beobachter.
Zu erahnen sei ein Mensch mit starken Minderwertigkeitskomplexen, der dies aber zu überspielen versuchte, wobei sein greisenhaft wirkendes Gesicht verstörend wirkte.
Zwischenzeitlich waren Ermittler in die Wohnung von Schumann gefahren und hatten diese durchsucht. Das Berliner Tageblatt vom 21. August sprach gar „von einer Wagenladung“ an Waffen, welche man gefunden hatte. Unter anderem jede Menge Gewehre, Munition verschiedenster Art, Handgranaten, Einbrecherwerkzeuge, darunter auch Gummihandschuhe, die wohl anscheinend zur Vermeidung der Fingerabdrücken dienten. Das gesamte Sammelsurium wurde zur Wache gebracht.
Immer mehr verdächtige Gegenstände wurden zutage gefördert, die aus Straftaten hätten stammen können, unter anderem zwei Uhren, eine Drillichjacke und eine Krawatte, wie die Zeitungen zu vermelden wußten.
Bei der Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung war Schumanns Ehefrau Anna anwesend und fiel „aus allen Wolken“, was die Kripo alles zutage förderte. Sie erzählte den Beamten, daß ihr Mann häufig nachts unterwegs gewesen sei und erst gegen drei oder vier Uhr in der Früh nach Hause gekommen sei, manchmal auch erst gegen sechs Uhr heimgekommen ist. Sie habe ihm deshalb auch Vorwürfe gemacht, doch er hätte sie dann bedroht und auch geschlagen. Er sei halt ein Wilderer, doch das dürfe niemand wissen. Von dem angeblich erlegten Wild hätte er aber nie etwas mitgebracht.
Nun wurden die Überfälle, Mordversuche mittels Schußwaffen, angebliche Selbstmorde, einfache Morde und Doppelmorde aus den letzten Jahren rund um den Falkenhagener See hervorgeholt und neu bewertet.
Vor einiger Zeit war der Schlosser Robert Kiwitt aus Blankenburg mit seiner Braut Martha Reich aus Berlin im Wald erschossen aufgefunden worden. Zunächst glaubte die Polizei, hier läge ein Doppelselbstmord vor und kein Verbrechen. Die Freigabe des Paares zur Beerdigung wurde veranlaßt. Doch eine Anzeige, vermutlich aus dem Kreis der Verwandtschaft, legte die ersten Spuren des Zweifels an der Doppelselbstmordtheorie und nun wurde daraus ein Doppelraubmord durch unbekannte Hand.
Der Berliner Lokal Anzeiger vom 22. August 1919 meldete:
„Gestern Abend gelang es, den Verhafteten eines Doppelmordes zu überführen, der bisher noch für ein Doppelselbstmord angesehen wurde. Der 22 Jahre alte Arbeiter Robert Kiwitt aus Blankenburg hatte am ersten Pfingstfeiertag mit seiner Braut, der 26 Jahre alten Arbeiterin Martha Reich aus der Huttenstraße, einen größeren Ausflug gemacht, und dazu sein Zelt und Schlafdecken mitgenommen. Von diesem Ausflug kehrte das Paar nicht zurück. Vier Tage später wurden beide als Leichen aus dem Falkenhagener See gelandet. Bei den Ermittlungen wurde besonderer Wert auf zwei Uhren gelegt, die der Verhaftete besaß. Aus der einen waren ein Monogramm und andere Zeichen ausgekratzt. Schumann gab an, daß er sie von einem Unbekannten am Hauptbahnhof in Spandau gekauft habe. Die Nachforschungen ergaben jedoch, daß die Uhren dem Kiwitt gehörten. Außerdem befand sich in dem Rucksack, den Schumann bei sich trug, eine Drillichjacke und eine Krawatte. Diese wurde dem Mörder zum Verhängnis. Sie war in einem Geschäft in der Huttenstraße gekauft worden und, wie festgestellt werden konnte, von der Martha Reich ihrem Bräutigam geschenkt worden. Trotz dieses schweren Belastungsmaterials leugnete der Verhaftete. Er hat sich aber bereits im Verhör wiederholt versprochen.“
Nun scheint sich Schumann, wenn man den Presseberichten glauben darf, zu umfangreichen Geständnissen bereitgefunden zu haben.
Meldung im Berliner Tageblatt vom 23. August 1919.
Über weitere Straftaten berichtete das Berliner Tageblatt am 23. August 1919. Unter der Überschrift schrieb die Zeitung: Geständnis des Falkenhagener Massenmörders .
"Fünf Morde, zahlreiche Raubüberfälle und Brandstiftungen zugegeben.“
“Unter der drückenden Last der Beweise hat heute Mittag der Spandauer Massenmörder Schumann dem Kriminalwachtmeister Lahmann ein weiteres Geständnis abgelegt. Er gibt nun zu, daß er den Schlosser Kiwitt und dessen Braut Berta Reich am Falkenhagener See ermordet und beraubt hat. Er habe zuerst Kiwitt erschossen, dann ‚die Reich’ vergewaltigt. Als sie um Hilfe zu rufen versuchte, habe er sie durch einen Schuß getötet. Auch den Mord an dem Gemeindewächter Engel aus Falkenhagen hat Schumann eingestanden. Engel habe ihn, als er eben von einem Einbruch zurückkehrte, angehalten. Es sei zwischen ihm und dem Wächter zu einem Kampf gekommen, wobei er Engel durch mehrere Schüsse niederstreckte. Ferner gibt Schumann jetzt zu, auch den Lehrer Paul in seinem Sommerhäuschen am Falkenhagener Forst ermordet zu haben. Paul hatte ihn einige Tage vorher im Walde dabei überrascht, als er eine Frau vergewaltigte wollte und ihn verscheucht. Aus Rache habe er Paul erschossen und dann den Versuch unternommen, seine Tochter und Frau in der Laube zu verbrennen. Ferner gestand Schumann ein, in den letzten Jahren im Falkenhagener Forst über zwanzig Frauen überfallen und vergewaltigt zu haben. Auch gibt er zu, einige Personen durch Schüsse schwer verletzt zu haben. Ebenso hat Schumann eine ganze Anzahl von Brandstiftungen, die ihm zur Last gelegt werden, ebenfalls eingestanden. Auch bestreitet er nicht mehr, daß er die Feuerwehrleute vom Falkenhagener Forst aus beschossen hat.
Von anderer Seite wird noch ergänzend mitgeteilt: Die geheimnisvollen Verbrechen, deren nun Schumann geständig ist, begannen im Januar 1916. Damals wurden im Walde bei Falkenhagen harmlose Berliner Wandervögel plötzlich beschossen, ohne daß sie den Täter sahen.
Im September stieß der Hegemeister Köpke mit einem Menschen zusammen, der mehrmals auf ihn schoß, ohne ihn zu treffen.
Am 1. Weihnachts-feiertage desselben Jahres kam ein Kanonier Hiller von Döberitz mit einem Mädchen nachmittags durch den Wald an jener Stelle vorbei, an der man Förster Nilbock erschossen hatte, und wurde plötzlich beschossen. Eine Kugel verletzte ihn, aber nicht lebensgefährlich.
Am nächsten Tage sah eine Frau Möbius in ihrer Villa in Falkenhagen im Erdgeschoß zu einem Fenster hinaus. Sie erblickte in einiger Entfernung im Walde einen Mann, ohne sich weiter im ihn zu kümmern. Plötzlich schoß dieser Mensch auf sie, fehlte sie aber zum Glück. Die Kugel schlug unterhalb des Fensters, in dem die Frau stand, in die Mauer ein. Der Mensch blieb auch jetzt noch stehen. Erst als auf die Hilferufe der Frau Möbius auch deren Mann am Fenster erschien, ging er weg, wie später Fußspuren im Schnee zeigten, nach Spandau zu. Das Ehepaar Möbius wohnte damals zur Winterzeit in Berlin und kam nur ab und zu nach Falkenhagen … „ (in einer anderen Schilderung, soll nach dem Schuß von Schumann, Frau Möbius zurückgeschossen haben. Beide Schützen ver
fehlten jeweils ihr Ziel).
Weiter berichtete die Zeitung von einem schweren Brandanschlag auf die Villa der Familie Möbius, sowie Diebstahl mehrerer geretteter Gegenstände die sich noch in dem Gebäude befanden.
Geradezu in einem „Geständnisrausch“ muß sich Schumann befunden haben, denn es wurde weiter berichtet, daß er auch davon sprach, im Mai 1917 auf eine Gruppe „Wandervögel“ blindlings geschossen zu haben. Einem Herrn Giebel aus Berlin hatte er dabei den Arm verletzt.
Auch Nachtwächter Engel wäre ihm zum Opfer gefallen.
Mehrere versuchte, sowie erfolgte Vergewaltigungen gestand Schumann nun ebenfalls ein.
Zum Schluß des Artikels des Berliner Tageblattes vom 23. August 1919 schrieb der Berichterstatter: „Was ihn zu seinen Untaten bewogen hat, ist im Einzelnen noch nicht klar. Von Geisteskrankheit ist an ihm nichts zu merken. Er ist nach den bisherigen Beobachtungen ein ganz kaltblütiger Verbrecher. Er sagt allerdings, daß die Personen, die er getötet oder durch Schüsse bedroht hat, ihn geärgert hätten. Er fühlte sich ständig verfolgt und wollte den Wald von allen Verfolgern und etwaigen Zeugen seiner schweren Bluttaten säubern.“
Die polizeiliche Personalakte des Schumann Repro: Landesarchiv Berlin
Von anderer Seite wurde eine fast kuriose Tat des Untersuchungshäftlings bekannt. Schumann hätte einmal eine Frau, die im Wald Blaubeeren pflückte vergewaltigen wollen und als diese schrie, ließ er von seinem Vorhaben ab und stahl, sozusagen als „Entschädigung“, den Eimer mit den eingesammelten Beeren.
Einen anderen Mord, der am 9. August an dem Arbeiter Edmund Lemm begangen wurde, wollte Schumann nicht auf sich nehmen und stritt dies vehement ab. Das Opfer war auf der Straße überfallen und durch zwei Schüsse getötet worden. Das mitgeführte Fahrrad, welches mit Gepäck beladen war, wurden dem Opfer geraubt. Schumann hatte für die fragliche Tatzeit ein wasserdichtes Alibi. Wie sich dann auch herausstellte, war der Täter ein polnischer Arbeiter mit Namen Rosalski aus Nowo-Radomsk. Das Fahrrad hatte er zwischenzeitlich vergraben, um nicht entdeckt zu werden. Einen Mitwisser des Raubmordes gab es zudem auch.
Friedrich Schumann gab sich in den nun täglich stattfindenden Vernehmungen kalt und gefühllos, wenn die Reden auf seine Opfer kamen. Die Zeitungen, die über ihn berichteten, bezeichneten ihn als Massenmörder und vertierten Menschen, dem jedes Rechtsgefühl zu fehlen scheint. Der „an Irrsinn grenzende Menschenhaß“ sei die Triebfeder seiner verbrecherischen Taten. Eine Affekthandlung könne man ihm nicht zubilligen. Auch nicht den Raub um sich zu bereichern, sondern Hass auf alle Menschen, die sich in „seinem“ Wald aufhalten würden. Beim Anblick fröhlicher, harmloser Spaziergänger sei er geradezu in einen Blutrausch verfallen. Laut schwadronierende Menschen seien ihm ein Greuel. Wer vor sich hinsingend im Forst unterwegs gewesen sei, hätte an der Schwelle des Todes gestanden. Lachende Menschen hätte er gehaßt und zunächst vorsichtig und hinterlistig verfolgt. Da er den Wald wie kein anderer kannte, wäre es ihm leicht gefallen sich unbemerkt langsam dem ausgesuchten Opfer zu nähern, bis er eine gute Schußposition einnehmen konnte. Dem ahnungslosen Opfer dann eine Lektion zu erteilen in dem er beschossen bzw. erschossen wurde, war ihm eine Wohltat. Wenn dabei eine Vergewaltigung oder ein Raub heraussprang, um so besser.
Die Wirkungsstätte Schumanns.
Das Waldgebiet rund um den Falkenhagener See in der Nähe Berlin-Spandau.
So reihte sich Straftat an Straftat, mal vollendeter Mord, mal versuchter Mord (das kann so bewertet werden, wenn das Opfer verletzt überlebt hat). Schumann hatte billigend den Tod des Opfers in Kauf genommen:
- 10. Mai 1917. Ermordung des Nachwächter Engel in Falkenhagen auf der Dorfstraße, nachdem ihn Engel bei einem Einbruch bei der Töpferei Schreiber verscheuchen wollte.
- 22. Juni 1918. Mord an dem Lehrer Paul in dessen Sommerhäuschen.
- 8. Juni 1919. Ermordung des Paares Kiwitt/Reich.
- 29. Juni 1919. Das Liebespaar Rietdorf/Biedermann wird ermordet. Der Mann wurde sofort erschossen, die Frau vor der Ermordung vergewaltigt. Raub der Wertsachen. Schumann vergrub die Leichen an verschiedenen Stellen im Wald.
- 18. August 1919. Forstaufseher Nilbock wurde erschossen.
- 15 Mordversuche fanden vom Juni 1916 bis Januar 1919 statt.
Es ist auch zu vermuten, daß es Fehlschüsse auf Passanten gab, die nur einen Schuß gehört hatten und nicht ahnten, daß er ihnen galt. Ein kurzer Schreck, doch da nichts weiter passierte, einfach weitergingen. Schumann hatte aus unbekannten Gründen dann von den anvisierten Opfern abgelassen.
Aus den Unterlagen geht allerdings auch ein Mordversuch Schumanns an der eigenen Schwester hervor. So soll er im Januar 1919 Frieda Schumann, die in Spandau, Müllerstraße 5, durch Kohlegase zu vergiften versucht haben, in dem er den Rauchabzug verstopft hatte. Er hatte es auf die der Schwester gehörenden Wertsachen abgesehen. Kurz zuvor hatte er 350 Mark, die unter dem Kopfkissen seiner soeben verstorbenen Mutter lagen widerrechtlich an sich genommen.
Aus den Vernehmungen des Untersuchungshäftlings wurde auch ein absonderliches Detail bekannt.
Zu lesen im Berliner Tageblatt, Abendausgabe, vom 28. August 1919:
“Die Höhle des Massenmörders - Zwei weitere Mordopfer gefunden.“
Das geheimnisvolle Verschwinden des 19 Jahre alten Volontärs Walter Ritdorf aus der Helmholtzstraße und der 18 Jahre alten Charlotte Biedermann aus der Goethestraße zu Charlottenburg ist jetzt aufgeklärt worden. Auch diese jungen Leute sind von dem Falkenhagener Massenmörder Schumann ermordet worden.
Gestern erfuhr nun die Kriminalpolizei, daß Schumann, der oft ganze Nächte von Hause weg blieb, ohne dass man sich seinen Aufenthalt erklären konnte, auch Höhlenbewohner war. Seine Schwester hatte von der Mutter einmal gehört, daß diese sagte, Fritz (von seiner Mutter wurde Friedrich immer Fritz genannt) wohne öfter in einer Höhle. Sie wisse wohl, wo sie liege, war aber noch nicht darin gewesen. Mutter und Tochter hatten die Absicht, sich diese Höhle doch einmal von innen anzusehen. Die Mutter erkrankte aber und starb, so daß es nicht mehr zu der geplanten Besichtigung kam. Kriminaloberwachtmeister Lahmann sandte nach diesen Feststellungen sofort einige seiner Beamten hinaus, um diese Höhle, die am Ufer des Falkenhagener Sees liegen sollte, ausfindig zu machen und durchsuchen zu lassen. Die Kriminalwachtmeister Seger, Hinze und Kunisch fanden denn auch etwa 400 Meter vom Seeufer entfernt, in einem Kiefern- und Birkengehölz, eine etwa vier Meter lange, zwei Meter breite und ebenso tiefe Höhle. Sie ist wohl schon vor zehn Jahren von Pennern ausgehoben und mit Hölzern versteift worden. Diese Hölzer sind verfallen, ebenso war auch die Höhle selbst teilweise eingestürzt. Trotzdem hatte Schumann sich darin aufgehalten. Die Beamten machten sich daran, sie wieder auszugraben und fanden auch bald etwa 25 bis 30 Zentimeter mit Erde bedeckt, die Leiche eines junges (sic!) Mannes, die noch verhältnismäßig gut erhalten war. Etwa 50 Schritt von der Höhle entfernt, fanden sie eine Stelle, die erkennen ließ, daß dort vor langer Zeit gegraben worden sein mußte. Hier fanden sie die Leiche eines jungen Mädchens, die nur etwas mehr als Handhoch mit Erde bedeckt war. Auf dem Kopf lag ein ausgestochenes Rasenstück. Das Mädchen war bis auf das Hemd, das Korsett und die Unterhose entkleidet. Die Leiche ist schon stark verwest. Nach anderen Funden ist zu schließen, daß das Paar von Schumann wahrscheinlich am Ufer erschossen und dann nach der Höhle verschleppt worden ist.“
Am 30. August 1919 wurde Schumann ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert und mußte dort auf seinen Prozeß warten.
Sein ihm beigestellter Anwalt hatte es mit seinem „Schützling“ nicht leicht und es zeigten sich unüberbrückbare Differenzen in der Bewertung der Verteidigungsstrategie, wenn der Prozeß vor dem Berliner Schwurgericht des Landgerichtes III zur Verhandlung kommt. Drei Tage vor Prozeßbeginn brach das Band zwischen Schumann und seinem Strafverteidiger ; dieser warf hin.
Dadurch kam das Gericht in große Not, da so kurzfristig kein Anwalt zur Verfügung stand. Oder doch?
Der Direktor des Landgerichtes fand einen Ausweg, in dem er den jungen und ehrgeizigen Anwalt Dr. Erich Frey für die Aufgabe gewinnen konnte, in letzter Minute die Offizialverteidigung für den Angeklagten Schumann zu übernehmen.
Frey las sich in die Akten ein und konnte nachvollziehen, warum sein Kollege hingeworfen hatte. Schumann, der sich in den ersten Vernehmungen durch die Kripo als völlig unschuldig zu den Vorwürfen bezeichnete, gestand aber letztendlich den Mord am Hilfsförster Nilbock. Weitere Straftaten stritt er allerdings vehement ab. Nach und nach räumte er die Anschuldigungen jedoch ein um sie vor Prozeßbeginn erneut abzustreiten. Er sei, so seine Aussagen, durch Schläge der vernehmenden Beamten zu den Geständnissen gezwungen worden. Er sei in Wahrheit unschuldig. Vor Gericht würden sich die Anschuldigungen als unwahr herausstellen.
Eine interne Untersuchung der Bezichtigungen des Untersuchungshäftlings, er sei durch Schläge zu Aussagen gezwungen worden, fand statt und erbrachte das Ergebnis, Schumann ist nicht geschlagen worden.
Am 5. Juli 1920 begann der Prozeß vor dem Berliner Schwurgericht III unter geradezu beängstigendem Publikumsandrang, wobei die Presse nicht vergaß, anzumerken, daß das weibliche Element die Mehrzahl im Gerichtssaal bildete. Schon im Eingangsbereich hätte es zerrissene Blusen, geknickte Strohhüte gegeben und den Justizwachtmeistern einen schweren Stand bereitet.
So lesen wir im Berliner Lokalanzeiger in der Abendausgabe vom 5. Juli folgende Meldung:
„Der Angeklagte wird, an den Händen gefesselt und mit der Gefängnisjacke mit den breiten Mörderabzeichen auf der Schulter, vorgeführt. Auf dem Zeugentisch liegen zwei Lederkoffer, gefüllt mit weiblichen Kleidungs- und Wäschestücken, die jetzt als Corpora Delicti dienenden Bekleidungsstücke seiner weiblichen Opfer.“
Nach Auslosung der Geschworenen und Verlesung des Eröffnungsbeschlusses gab der Offizialverteidiger folgende Erklärung ab: „Meine Herren Richter und meine Herren Geschworenen! Ich stehe hier, lediglich als eine Art Folgeerscheinung des § 140 StGB, welcher bestimmt, daß jede, vor dem Schwurgericht angeklagte Person, einen Verteidiger haben muß. Von Amts wegen bin ich zum Verteidiger bestellt worden und habe diese erst am Freitag übernommen und zwar, ich spreche das offen aus, nicht ohne große Bedenken und nicht ohne wohl für jeden begreiflichen Widerwillen. Ich habe schließlich die Verteidigung übernommen aus reinstem Interesse für die soviel erwähnte Psychologie des Verbrechens und, so paradox es klingen mag, im Interesse der Menschheit. Es spricht zu Ihnen jetzt weniger der Verteidiger des Schumann, als vielmehr der Verteidiger der Menschheit.“
Erich Frey hatte sich seine Strategie so zurechtgelegt, daß es nur eine Rettung vor dem Todesurteil geben konnte, wenn das Gericht den Angeklagten für unzurechnungsfähig bzw. geisteskrank erklären würde. Doch es lagen schon zwei Gutachten der Ärzte Hoffmann und Straßmann vor, die zwar „eine gewisse Minderwertigkeit“ und „Entartungserscheinungen“ dem Angeklagten attestierten, jedoch den § 51 StGB nicht zubilligen wollten. Frey beantragte darauf die Hinzuziehung weiterer Gutachter, doch das Gericht lehnte den Antrag ab. Schumann selbst wollte keinesfalls für unzurechnungsfähig erklärt werden und unterstützte seinen Verteidiger darin nicht.
Am 5. Juli 1920 begann der Prozeß vor dem Berliner Schwurgericht III.
Am ersten Verhandlungstag erschien auch die Ehefrau des Angeklagten, Anna Schumann, vor Gericht. Sie schilderte ihren Mann als jemanden, der ihr oft Angst eingejagt und sie auch geschlagen habe. Er sei bei den geringsten Anlässen in gewaltige Wut geraten, „wobei seine Augen rollten“. Er sei halt leicht jähzornig geworden und hätte Geschirr zerschlagen. Nein, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen und geraucht hätte ihr Mann nur recht wenig.
Durchaus gläubig sei ihr Mann gewesen und auch häufig in die Kirche gegangen. Er habe vor der gemeinsamen kirchlichen Vermählung darauf gedrungen, daß bei der Feier keine Musik gespielt werden dürfe, weil Schumanns Mutter kurz vorher gestorben sei. Frau Schumann wußte davon, daß ihr Mann einmal in einem Brief an die Schwester geschrieben hatte, in dem gestanden habe: „Wir sehen uns einmal alle im Himmel wieder.“
Dann wurde die Zeugin und Ehefrau aufgefordert etwas zum Sexualleben ihres Mannes zu sagen. Wobei sie berichtete, es sei wohl dabei ein ausgeprägtes sadistisches Verhalten zu bemerken gewesen.
Anna Schumann ist auch aufgefallen, daß ihr Mann „keine fröhlichen Menschen habe sehen können“, er sei plötzlich aus einer Gesellschaft fröhlicher Menschen weggelaufen (Berliner Lokalanzeiger 6. Juli 1920 - Abendausgabe). Die Zeitungen bezeichneten den Angeklagten darauf als ausgesprochenen Melancholiker und blutigen Sonderling. Ansonsten, so berichtete Anna Schumann weiter, sei ihr Mann aber ordentlich und fleißig gewesen. Den Wochenlohn hätte er ihr fast immer ganz abgegeben.
Eine Tante berichtete dem Gericht von einer schweren Kindheit des Angeklagten. Der Vater habe wegen eines Sittlichkeitsverbrechens ein Jahr im Zuchthaus einsitzen müssen und dadurch sei die Ehe geschieden worden. Für die Familie habe er nicht gesorgt, trotz der acht Kinder, die das Paar hatte. An den Beinen gepackt habe dieser Unhold einmal seinen Sohn und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Erst das Einschreiten der Nachbarn hatte Schlimmeres verhindert. Das Kind habe viel geweint und keiner Fliege ein Bein ausreißen können. Er sei ein lieber Junge gewesen, so die Tante.
Der Vater erschien auch vor dem Schwurgericht und erkannte den Sohn als den Seinen nicht wieder.
In einer Gegenüberstellung im Gerichtssaal erkannten den Angeklagten auch zwei Männer und deren Begleiterinnen nicht wieder, die einen Ausflug zum Falkenhagener See unternommen hatten und dabei den in feldgrauer Uniform auffällig umherstreifenden Mann sahen. Die jungen Frauen waren durch den „merkwürdigen Menschen“ ängstlich geworden, weil sie meinten, er hätte so „unheimliche Augen“. Kurz nach dieser Begegnung wäre ihnen eine Pistolenkugel um die Ohren geflogen und gleich darauf ein zweiter Schuß gefallen, der einen der Männer im Oberarm traf.
In den späteren Vernehmungen bei der Kripo hatte Schumann dem Kriminaloberwachtmeister Lahmann diesen Vorfall bestätigt und als Begründung genannt, er habe die Leute dadurch nur verjagen wollen.
Schumanns Verteidiger Dr. Dr. Erich Frey
Dem Gerichtsdirektor Pioletti, der dem Gericht vorsaß, erklärte der Angeklagte nun, er sei nicht der Täter. Das damals abgelegte Geständnis dem Beamten gegenüber sei erzwungen gewesen.
Am 8. Juli 1920 berichtete der Berliner Lokalanzeiger von der konstanten Taktik des Angeklagten alle ihm zur Last gelegten Straftaten zu leugnen bzw. zu widerrufen und schrieb dann weiter: „Alle Fragen, die auf ein Schuldbekenntnis hinzielen, werden von ihm mit nein beantwortet, und zwar so schnell, daß die Antwort oft erfolgt, ehe der Vorsitzende noch zu Ende gefragt hat. Er erklärt seine Geständnisse durch die Polizei mit dem auf ihn ausgeübten Zwang, die von dem Richter mit dem Wunsche, schnell zu der öffentlichen Gerichtsverhandlung zu kommen.
Dieses Verfahren versagte allerdings im Falle des Doppelmordes an dem Schlosser Kiwitt und seiner Braut Martha Reich, die ihren Untergang bei einem Ausfluge nach dem Falkenhagener See gefunden hatte. Am 10. Juni 1919 wurden ihre Leichen am Nordrande des Sees im Schilfe aufgefunden. Die Leiche des Mannes zeigte eine Schußwunde im Gesicht, die Leiche des Mädchens eine Schußwunde auf der Brust. Ursprünglich wurde ein Doppelselbstmord angenommen. Deshalb hatte man in diesem Fall auch keine weiteren Ermittlungen angestellt. Allerdings waren die Kleidungsstücke des Mädchens merkwürdigerweise gewaltsam aufgerissen worden und Geld, Wertsachen sowie Ausrüstungsgegenstände fanden sich weder bei der Leiche, noch in der Nähe. Hier hätten die Ermittler eigentlich stutzig werden müssen. Wurden sie aber nicht. Nach Aussage des Vaters Kiwitt hatte er seinem Sohn eine Uhr mit einer beseitigten Eingravierung geschenkt. Das genau ist diese Uhr, dazu der Schlips und der Rucksack des Sohnes welche man nun im Besitz des Angeklagten vorgefunden hatte. Der Zeuge erkennt diese Sachen mit aller Bestimmtheit als die seines Sohnes wieder und bestreitet vehement, daß hier von einem Selbstmord der jungen Leute die Rede sein könne.“
- Vors. (zum Angeklagten): „Wie kamen sie zu der Uhr? „
- Angekl.: „Ich habe die Uhr, den Rucksack und den Schlips am Falkenhagener See gefunden; die Sachen lagen im Schilf.“
- Vors.: „Warum haben Sie die Sachen behalten?“
- Angekl.: „Ich wollte sie aufbewahren, bis sich jemand meldet. In dem Rucksack war nichts drin.“
- Vors.: „Haben Sie die gefundene Uhr denn Ihrer Frau gezeigt?“
- Angekl.: „Nein“.“
Verwundert zeigte sich nicht nur der Richter als Schumann hinzufügte, um die Gegenstände sicher aufzubewahren, hätte er diese in ein Pfandleihhaus gegeben. Wenn sich der Besitzer gemeldet hätte, wären sie ihm auch zugestellt worden.
Unmittelbar darauf kam es im Gerichtssaal zu einer dramatischen Szene als der Vorsitzende den besagten, beim Angeklagten gefundenen Schlips, zeigte.
Laut schluchzend und wehklagend erkannte Frau Kiwitt den Gegenstand ihres ermordeten Sohnes wieder und stürzte sich auf Schumann mit den Worten: “Du Strolch hast mir meinen Sohn ermordet“ und will auf ihn einschlagen. Dieser stand ungerührt mit verschränkten Armen da, als ginge ihn das alles nichts an.
Amtsvorsteher Freymuth berichtete davon, daß es in der fraglichen Zeit, in der Schumann gemordet hat, zu Wohnungskündigungen und sogar Hausverkäufen gekommen war und die verängstigten Familien verzogen sind. Nach der Verhaftung hätten dann die Morde auch schlagartig aufgehört.
Noch einmal wurde die Ehefrau des Angeklagten gehört. Diesmal zu den Wertgegenständen, die von der Polizei in der gemeinsamen Wohnung gefunden wurden. Diese erklärt, die Ohrringe, die man fand, gehörten wohl ihrer inzwischen verstorbenen Schwiegermutter, zumindest hätte das ihr Mann so gesagt. Es sei ein Andenken an seine Mutter. Die Uhr hätte er mal von seinem Onkel geschenkt bekommen. Sie habe aber dabei den Eindruck gehabt, die Fragen danach seien ihrem Mann lästig gewesen.
Der Angeklagte war bei den polizeilichen Vernehmungen, anfangs durch den Amtsrichter Wielan, erstaunlich gelassen, ruhig und sachlich und zeigte keinerlei Erregung. Auch hier im Gerichtssaal war er scheinbar der Einzige, der völlige Gelassenheit zeigte, wobei er zeitweilig dem Richter gelangweilt den Rücken zudrehte.
Auch am folgenden Gerichtstag beharrte Schumann darauf, daß er nur durch die Mißhandlungen der Polizei die Geständnisse unterschrieben habe. Dazu wurde am 9. Juli 1920 Kriminalkommissar Kuntze vernommen, der aussagte, eine Stenotypistin, die bei den Vernehmungen dabei war, hätte ihm mitgeteilt, Schumann sei in übertriebener Weise mißhandelt worden. Die Schreibkraft habe sich sogar einmal schützend vor Schumann gestellt. Auch seien ein blaues Auge und ein geschundenes Gesicht so offensichtlich gewesen, daß Schumann nicht fotografiert werden konnte. Darauf sei im Kommissariat eine große Unruhe entstanden und eine Untersuchung der Vorwürfe angeordnet worden. Doch mehrere, mit dem Fall betraute Kripoleute bekundeten, der Untersuchungshäftling sei korrekt behandelt worden. Er hätte sogar „Essen und Zigaretten“ erhalten. Lediglich die Treppe sei er einmal hinuntergefallen.
Das Gericht kündigt darauf eine weitere Untersuchung an und vertagte sich.
Am folgenden Gerichtstag wurde die Stenotypistin, Fräulein Wehn, zu diesem Punkt vernommen und diese erklärte nun, es hätte keine Angriffe bei den Vernehmungen gegeben, alles sei ein Mißverständnis. Die festgestellten Verletzungen seien tatsächlich durch einen Treppensturz hervorgerufen worden.
Schumanns Verteidiger Erich Frey beabsichtigte es dabei zu belassen, doch der Staatsanwalt beantragte eine vollständige Aufklärung der Angelegenheit. Es waren wohl nur „innerbetriebliche häßliche Eifersüchteleien“ (heute würden wir es wohl Mobbing nennen) die zu der Verwirrung führten, war am nächsten Tag zu hören. Damit war das unangenehme Intermezzo beigelegt.
Nach der aufgeregten Erörterung dieses Punktes kam das Gericht zu den Vorkommnissen, die zur Verhaftung geführt haben.
Dabei kam völlig unerwartet das Gericht zu einem ganz anderen Aspekt, mit dem niemand gerechnet hatte. Die Frage, reichlich spät, tauchte auf, ob dieses Gericht überhaupt zuständig für Schumann sei und nicht doch eher ein Militärgericht? Der Angeklagte war als Soldat noch gar nicht entlassen worden. Der Staatsanwalt solle es umgehend klären und sagte dies auch zu. Zum nächsten Gerichtstermin hatte dieser den Rechtssachverständigen des Kriegsministeriums geladen und es wurde festgestellt, daß Schumann doch vom Soldatenrat in Spandau entlassen worden sei. Erich Frey war zwar nicht sonderlich überzeugt, beließ es aber dabei.
Nun kam aber noch einmal die Gesichtsverletzung des Angeklagten zur Sprache und dazu erklärte der Zeuge Rietdorf, ein Bruder eines von Schumanns ermordeten Opfers, bei einer Gegenüberstellung mit Schumann habe er diesen erkannt und war mit erhobener Faust auf ihn losgegangen, aber sich im letzten Moment zurückhalten können.
Der Prozeß gegen den Angeklagten wendete sich der Frage zu, welche Notzuchtsfälle müssen dem Angeklagten zur Last gelegt werden? Dazu wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, doch die Pressevertreter durften bleiben.
Der „Berliner Lokalanzeiger“ vom 12. Juli 1920 berichtete in der Abendausgabe dazu: “Eine Zeugin, Frau G., befand sich im Juni 1917 mit ihrer damals 4jährigen Tochter im Forst, als ein Unbekannter hinterrücks auf sie losstürzte, sie zu Boden warf, am Halse würgte, und den Versuch machte, sie zu vergewaltigen. Auf das Geschrei des Kindes und auf die Hilferufe eilte der Lehrer Paul herbei, der bekanntlich, wie die Anklage behauptet, später von Schumann aus Rache für die Störung ermordet worden sein soll. Die Zeugin erklärt heute unter ihrem Eide, daß sie den Angeklagten mit aller Bestimmtheit wiedererkenne.“
- Angeklagter Schumann: „Ich kenne die Frau nicht.“
- Vorsitzender: „Sie haben aber doch ein Geständnis abgelegt.“
- Angeklagter: “ Es hängt mit den anderen Geständnissen zusammen. Ich habe mit der Sache nichts zu tun.“
Am selben Tage, an welchem die Vorzeugin überfallen worden war, hatte auch die als Zeugin aufgetretene Frau S. ein sehr böses Abenteuer. Sie wurde von einem Manne hinterrücks überfallen und am Halse gewürgt. Als sie sich wehrte, schlug ihr der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht, so daß sie aus Mund und Nase blutete. Dann schleppte der Unbekannte die Zeugin in das Schilf des nahen Sees. Die Zeugin wurde besinnungslos und weiß nicht genau, was geschehen ist. Endlich ließ er von ihr ab mit den Worten: “Du, wenn du was sagst, mach ich dich kalt!“
Auf Befragen, ob sie in dem Angeklagten den Täter wiedererkenne, antwortete die Zeugin: “Selbstverständlich!“ Auch diese Zeugin gab als Haupterkennungsmerkmal eine Zahnlücke an, welche der Angeklagte auch tatsächlich hatte.
Die Zeitung endete ihre Berichterstattung mit der Meldung: “Die Verhandlung wird schließlich auf Dienstag vertagt. Dann sollen die Sachverständigen ihre Gutachten abgeben. Den Geschworenen werden wahrscheinlich einige 50 Schuldfragen vorzulegen sein.“
Die vom Gericht bestellten Gutachter haben als Strafmilderungsgrund die schwere Jugend des Angeklagten ausgiebig gewürdigt, jedoch dadurch keine Abschwächung des Strafmaßes empfohlen. Sie empfahlen dem Gericht den § 51 StGB („Wer schuldunfähig ist, kann in unserer Rechtsordnung nicht bestraft werden ... Die Schuldunfähigkeit ist Strafausschließungs-, die verminderte Schuldfähigkeit Strafmilderungsgrund.“) nicht zur Anwendung zu bringen.
Der Staatsanwalt würdigte ebenfalls die ungünstigen Familienverhältnisse in Schumanns Kindheit. Auch sei der Angeschuldigte immer ein tüchtiger und fleißiger Arbeiter gewesen. Doch die Härte des Gesetzes müsse zur Anwendung kommen.
Dr. Erich Frey, der Verteidiger, hatte in seinem Plädoyer auf Totschlag und mildernde Umstände erkannt. „Der Angeklagte braucht einen Arzt und nicht den Henker“ rief er aus. Schumann nahm das Urteil kaltlachend entgegen und erklärte nichts mehr sagen zu wollen.
Am 17. Juli 1920 vermeldete der Berliner Lokalanzeiger unter der Überschrift „Schumann zum Tode verurteilt“ das Ende des Prozesses. Es war der achte Tag der Verhandlung.
Die Tageszeitung vermeldete, daß noch „in später Abendstunde“ der Richterspruch erfolgte. Sechs Fälle wurden für Mord gewertet und somit erhielt Schumann für jeden einzelnen Mord die Todesstrafe. Ein Mordversuch wurde erkannt, sowie eine Mordbrennerei, viermal Notzucht, einmal schwerer Diebstahl, dreimal einfacher Diebstahl, zwei Unterschlagungen. Für all diese Verbrechen erhielt er lebenslänglich Zuchthaus. Der lebenslängliche Ehrverlust fiel für den Verurteilten wohl nicht mehr schmerzlich ins Gewicht.
In den anschließenden Gesprächen zwischen Erich Frey und Friedrich Schumann versuchte der Anwalt, Einfluß auf diesen zu nehmen und seine Zustimmung zur Beantragung einer Revision zu erlangen. Dies war bei Todesurteilen auch üblich, doch der Verurteilte weigerte sich, dem zuzustimmen. Doch Frey tat, was er für richtig hielt und ging in Revision.
Nach fünf Wochen erhielt dieser einen Brief seines Klienten mit folgendem Wortlaut: “Sehr geehrter Herr Dr. Dr.! Ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich verzichte auf Revision und wünsche deren Rücknahme. Ebenso widerspreche ich einem von Ihnen beabsichtigten Gnadengesuch, da ich meiner Meinung nach unschuldig verurteilt worden bin und das Gericht für meine Todesstrafe die Verantwortung trägt. Ich beanspruche als mein Recht, daß bald der Tod mich treffe ... Hochachtungsvoll Friedrich Schumann.“
Frey beugte sich und zog die Revision zurück.
Für Frey war damit der Fall Schumann nicht abgeschlossen, wie man meinen könnte. Mehrmals besuchte er ihn im Strafgefängnis Plötzensee und führte Gespräche mit dem Verurteilten auf der Station III in Zelle 301.
Dabei lernte er eine merkwürdige Philosophie kennen, die Schumann eigen war. Es war eine Mischung aus tiefer Menschenverachtung und verquerter Naturphilosophie. Die Liebe zum Wald, der Falkenhagener Forst, eine schöne, reizvolle Landschaft, die geschützt werden mußte, besonders vor Menschen, die Frohsinn, Lebensfreude empfanden, ja, gern lachten. Er haßte das Lachen! Das alles kannte Schumann ja nicht. Das alles verabscheute er und von diesen Störern mußte der Wald gereinigt werden. Solche unwürdigen Eindringlinge hatten hier nichts zu suchen und mußten vertrieben werden. Es war sein Wald und hier galt sein Gesetz!
Auch sei er bei seinen Naturbeobachtungen gestört worden, das hätte ihn wütend gemacht, sagte er einmal. Die Männer schoß er nieder, die Frauen gehörten ihm. Aber er hatte auch eine tiefe Kenntnis der Vorgänge in der Natur. Er wußte Vogelstimmen zu deuten und kannte die verschiedensten Baumarten. Wenn er mit seinem Anwalt darüber sprach, lockerten sich seine Züge um den Mund und die Augen wurden fast sanft, bemerkte sein Anwalt.
Am 26. August 1921, es war ein Sonntag, besuchte Frey seinen Klienten ein letztes mal in Plötzensee und sah dem Todeskandidaten bei seiner Henkersmahlzeit zu (Bouletten, Teltower Rübchen, Grieß-Flammerie mit Blaubeer-Kompott). Dabei soll nach Aussagen des Anwaltes, Schumann die ganze Wahrheit seiner verbrecherischen Taten eingestanden haben. Fünfundzwanzig Morde habe er begangen behauptete Schumann nun fünf Stunden vor der angesetzten Hinrichtung.
Erich Frey meinte nicht richtig gehört zu haben, und forderte Schumann auf, dies schriftlich darzulegen, um kurzfristig zumindest die Hinrichtung im letzten Moment noch aufschieben zu können. Ein neues Verfahren ließe sich durchaus anstrengen, um ihn dem Psychiater und nicht dem Henker zu überantworten, was er ja schon in der Verhandlung gefordert habe.
Frey erhielt das eilig niedergeschriebene Schriftstück, mußte aber seinerseits versichern, dies erst nach der vollzogenen Hinrichtung* zu verwenden. Und so geschah es. Schumann verabschiedete sich von Frey mit den Worten: “Na, dann vielen Dank für alles. Viel Glück im Leben und machen sie sich nicht soviel Gedanken um mich, es lohnt nicht.“
______________________
Hinrichtungen *: In der Regel fanden Vollstreckungen in Plötzensee wie in anderen Hinrichtungsstätten am frühen Morgen statt. Die bevorstehende Hinrichtung mußte den Verurteilten am Abend vorher von einem Staatsanwalt im Beisein von weiteren Beamten mitgeteilt und darüber ein Protokoll angefertigt werden. Danach wurden die Todeskandidaten in einem besonderen Flügel des Hauses III gebracht, dem "Totenhaus", streng bewacht, später auch gefesselt, und erhielten dann nur noch den Besuch ihres Anwalts und des Anstaltsgeistlichen. Bei Tagesanbruch führten Gefängnisbeamte die Gefangenen einzeln, mit auf dem Rücken gefesselten Händen, in den Hinrichtungsschuppen unmittelbar neben dem Haus III. Dort wurde vor den Anwesenden das Urteil verlesen und dem Geistlichen Gelegenheit für ein kurzes Gebet gegeben. Danach ergriffen die Gehilfen des Scharfrichters das Opfer, und der Henker tat seine Arbeit. Erst im Februar 1937 wurde das Fallbeil in Plötzensee aufgestellt und damit die Urteile vollstreckt. Bis zu dieser Zeit wurde stets mit dem Handbeil enthauptet.
Hinweis: |
Danach wurde der Todeskandidat von ärztlicher Seite auf seinen Gesundheitszustand vom Sanitätsrat Dr. Lehnsen untersucht und dem aus Magdeburg angereisten Scharfrichter Gröpler überantwortet.
Im Laufe des Prozesses ist einmal ein Brief verlesen worden, den Schumann an seine Tante in Spandau geschrieben hatte. Der Wortlaut: “Ich weiß sehr gut, daß wegen meiner ein großes Geschrei entstanden ist, welches im Laufe der Zeit sicherlich bald wieder verstummen wird. Ich habe im Augenblick die tröstliche Hoffnung, daß auch Du nicht schlecht von mir denken wirst, im Gegensatz zu der von der Presse so künstlich aufgeregten großen Masse. Ich habe nichts Derartiges getan, wie mir zur Last gelegt wird. Das Schwerste muß ich ja nun auf mich nehmen; so scheint mir auch das vom Schicksal bestimmt zu sein, daß ich in meinem ganzen Leben nie glücklich sein soll. Wie dem auch sei: Trotz allem will ich mein Unglück mit Geduld auf mich nehmen. Es hat alles einmal ein Ende.“
Friedrich Schumann wurde am 27. August 1921 morgens von dem preußischen Scharfrichter Carl Gröpler aus Magdeburg enthauptet.
Info:
Der Scharfrichter Franz Friedrich Carl Gröpler
(* 22. Februar 1868 in Magdeburg; † 30. Januar 1946) war preußischer Scharfrichter von 1906 bis 1937 und nahm Hinrichtungen in Preußen, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen und den Hansestädten vor. Gröpler war einer der bekanntesten Scharfrichter Deutschlands.
Nachbemerkungen zu Friedrich Schumann:
Wenn man die Geschichte des Serienmörders Schumann schreibt, muß der Autor bald feststellen, das Quellenmaterial recht ist dünn. Zumindest was das Originalmaterial angeht. Aufsätze, Beiträge und eine Romanvorlage über Schumann gibt es sogar, doch wo ist der wahre Schumann?
Eine der „guten“ Quellen ist das Staatsarchiv Potsdam. Dort ist ein Vermerk in der Zentralkartei für Mordsachen von 1919 zu finden. Hier kann der Suchende einige knappe Angaben nachlesen wie beispielsweise: “Urteil: Schumann wurde zum Tode verurteilt und später erschossen.
Die Zeit ist nicht bekannt, ebensowenig das Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft.“ Oder: “Die Personalakten des Schumann S. 203655 sind nicht mehr vorhanden, anscheinend wurden sie der Vorschrift entsprechend, vernichtet.“
In dieser Zentralkartei für Mordsachen ist ein Merkblatt vorhanden, aus welchem hervorgeht, welche Straftaten dem Schumann zur Last gelegt wurden. Im Kriminalmuseum Berlin findet sich ein gleiches Merkblatt, sonstige Akten nicht.
Aus den Merkblättern ist zu ersehen, daß dem Schumann 7 vollendete Morde, 15 versuchte Morde, 5 Brandstiftungen, 11 versuchte und vollendete Notzuchtvergehen, 9 einfache und schwere Diebstähle und 3 Raubüberfälle zur Last gelegt wurden. Schumann ist nach der Notiz im Kriminalmuseum 1921 in Plötzensee hingerichtet worden. „Meyer....(handschriftlich).“
Die damalige Berichterstattung in den Berliner Tageszeitungen ist dafür um so ergiebiger. Die Presse hat den Fall ausführlich und nahezu täglich den Lesern nahe gebracht. Auch hat der oben mehrmals zitierte Verteidiger Prof. Dr. Dr. Erich Frey auf 29 Seiten seine Erlebnisse in einem Buch mit dem Titel „Ich beantrage Freispruch“ geschildert. Der Autor Frey schildert gut lesbar seine Arbeit und seinen Einsatz für Schumann. Fast anekdotenhaft reiht er die Vorgänge aneinander und zeichnet so ein lebendiges Bild seines Schützlings.
Trotzdem wurde auf den Text des Buches kaum Bezug genommen. Warum?
Es sind zeitweilig erhebliche Widersprüche zwischen der Berichterstattung in der Presse und den Lebenserinnerungen des Verteidigers, die erst im Herbst 1959 in Santiago de Chile niedergeschrieben wurden.
Beispiel:
- 1. Es geht um den Hilfsförster Nilbock, den Schumann als letztes Opfer mit Schrotkugeln angeschossen hatte und der kurz darauf starb. Berliner Tageblatt 20. August 1919: „Sein Vater war auch Förster und wurde ebenfalls im Falkenhagener Wald von Wilderern erschossen“. Erich Frey schreibt in seinen Lebenserinnerungen: “Im deutschen Gerichtssaal sitzt der Verteidiger unmittelbar vor seinem Klienten. Die Vernehmung des alten Spandauer Försters Nilbock, dessen Sohn Schumanns letztes Opfer gewesen war, war eben beendet. Schluchzend, mit von Tränen erstickter Stimme hatte der Förster den guten Charakter seines Jungen geschildert. … Weinend nahm der Alte in der ersten Reihe der Publikumsbänke Platz. Ich hatte mich erhoben, da hörte ich hinter mir unterdrücktes Rufen ... Ich fuhr herum. In diesem Augenblick fiel aus der Hand des Försters ein Revolver zu Boden. Die hinter ihm sitzende Dame hatte ihm die Waffe, die er auf Schumann und mich angelegt hatte, aus der Hand geschlagen. Die Dame war ... meine Frau.“
Dieses hochdramatische Ereignis in einem deutschen Gerichtssaal erwähnt keine einzige Zeitung! Nicht vorstellbar ist, daß die Berichterstatter dies nicht bemerkt hätten. Nilbock sen. war doch nach Meldung der Presse gar nicht mehr am Leben.
- 2. Erich Frey schreibt: “Er (Schumann) erzählte monoton, sachlich und doch faszinierend.“ Auch die Presse bemerkte nicht einmal einen Sprachfehler Schumanns. Hingegen erwähnten zwei Autoren, gerade dieses. Franz von Schmidt in „Vorgeführt erscheint“. Schmidt war Autor mehrerer Bücher und ging damals im Kriminalhauptamt in Berlin ein und aus. Er berichtet im o.g. Buch von einer Begegnung mit Schumann vom August 1919: “ ...er machte den Eindruck starker Minderwertigkeit, der sich durch ein starkes Stottern, eine heillose Verkrampftheit und Gehemmtheit noch verstärkte.“ Ein weiterer Autor, Hans Hyan, schrieb schon 1924 in seinem Buch „Tiermenschen“ über Schumann: „...er sei im hohem Grade Stotterer und zeigt so offensichtlich schwere Sprachhemmungen.“
- 3. In dem oben erwähnten Buch „Tiermenschen“ findet sich eine weitere Ungereimtheit zu den Presseberichten im Fall des Brandanschlages auf die Familie Paul. Nachdem Schumann das kleine Sommerhäuschen angezündet hatte und den Familienvater durch die Tür erschossen hat, hört Schumann die Hilferufe der kleinen Tochter der Familie, die sich noch im Haus aufhielt - sie seien doch auch nur arme Leute, den Vater habe er schon erschossen, er möchte sie doch in Frieden lassen! Und da scheint es, als ob diesem jungen Mädchen gegenüber, das noch ein Kind ist, die weiche Seite in Schumanns umdüsterter Seele wieder klänge. Er selbst ist ja infantil, seine Vorstellungen sind kindlich zurückgeblieben, so versteht er die Sprache des Kindes am leichtesten und empfindet Mitleid, wo er Erwachsenen gegenüber nur kalten Hohn und die Wollust der Grausamkeit fühlt. Im Berliner Tageblatt vom 23. August ist von Mitleid des Schumann keine Rede, wenn es hieß: “... Frau und Tochter entgingen dem Feuertode. Es gelang ihnen, die Verrammelung zu sprengen und ins Freie zu kommen.“
- 4. Die Schreibweisen der Namen, die in diesem Drama auftauchen, ist sehr verschieden. Der Arzt, bei dem Schumann verhaftet wurde lautet bei Frey, Hyan und Schmidt, „Tegling“, in der Presse „Teffling“. Auch innerhalb der Presse gibt es unterschiedliche Schreibweisen besonders, was die Namen angeht. Mal wurde der Förster „Nielbock“, mal „Nilbock“ genannt. Das Paar Robert „Kiwitt“ und „Martha Reich“, das erschossen aufgefunden wurde, die Frau erhielt in der Presse auch den Namen „Berta Reich.“
- 5. Das Gerichtsurteil, daß über Schumann gefällt wurde, ist in den vorliegenden Schriften scheinbar unterschiedlich ausgefallen. Zwar wurde die Anzahl der erkannten Morde gleich wiedergegeben (bei Frey sind es 6, in der Presse ebenfalls), doch dafür ist die Anzahl der Zuchthausjahre unterschiedlich. Erich Frey schrieb von 10 Jahren, der Lokal Anzeiger von 15 Jahren Zuchthaus.
Da die entsetzlichen Taten des „Schrecken des Falkenhagener Forstes“ zuerst mit dem Tode gebüßt werden mußte, ist dies vielleicht vernachlässigbar.
Er ist heute fast vergessen. Andere Namen von psychotischen oder psychopatischen Mördern kamen und gingen. Doch Friedrich Schumann hat mit seinen Taten den unehrenhaften Platz eingenommen, als einer der ersten Serienmörder in Deutschland im letzten Jahrhundert.
Quellen:
• Berliner Tageblatt vom 19. August 1919 – Juli 1920
• Berliner Lokalanzeiger, ebenso
• „Ich beantrage Freispruch“ aus den Erinnerungen des Strafverteidigers.
• Prof. Dr. Dr. Erich Frey 1960, Bertelsmann
• „Tiermenschen“ Hans Hyan, Josef Singer Verlag / Leipzig 1924
• „Vorgeführt erscheint“, Franz von Schmidt, 1955, Verlag Deutsche Volksbücher, Stuttgart
• Staatsarchiv Potsdam, Pr.Br.Rep. 30 Berlin C Polizeipräsidium Berlin
• Zentralkartei für Mordsachen 1919
Bildquellen: • erichs-kriminalarchiv.com
12. Der Fall - Johan Alfred Anderson Ander
Johan Alfred Andersson Ander (* 7. Oktober 1873 in Ljusterö, † 23. November 1910 in Stockholm) war der letzte Mensch, der in Schweden hingerichtet wurde. Von Beruf war Ander Gastwirt. Er befand sich häufig in finanziellen Schwierigkeiten und hatte Alkoholprobleme. Seine Frau sagte in der Gerichtsverhandlung aus, ihr Mann habe sie mehrfach misshandelt und sie habe um ihr Leben gefürchtet. Ander war bekannt als Kleinkrimineller und wurde mehrfach verhaftet.
Am 5. Januar 1910 überfiel Ander die Bank Gerell in der Stockholmer Malmtorgsgatan 3. Er attackierte die 24jährige Kassiererin Viktoria Hellsten und verletzte sie so schwer, dass sie eine Stunde nach dem Überfall im Serafinnerlazarett verstarb. Er entkam mit 6000 Kronen. Ein Teil des Geldes wurde als Beweismittel gegen Ander verwandt, da einige Scheine Blutstropfen aufwiesen.
Ander bestritt bis zuletzt, die Tat begangen zu haben. Nach dem Todesurteil am 14. Mai 1910 ging er mehrfach in Revision, die jedoch in allen Instanzen abgelehnt wurde. Am 23. November 1910 wurde Ander auf Långholmen als letzter Mensch in Schweden hingerichtet. Vollstreckt wurde das Urteil durch Schwedens letzten Henker Albert Gustaf Dahlman mithilfe der Guillotine, die 1903 aus Frankreich importiert worden war und damit zum einzigen Mal in Schweden verwendet wurde.
1921 schaffte Schweden die Todesstrafe für Friedenszeiten ab. 1973 wurde sie endgültig abgeschafft.
Albert Gustaf Dahlman (* 17. Februar 1848 in Norberg, Gemeinde Norberg als Anders Gustaf Dalman; † 30. Juli 1920 in Stockholm) war von 1885 bis zu seinem Lebensende ein schwedischer Scharfrichter und der letzte, der ein Todesurteil in Schweden vollzogen hat. |
Quellen: Aftonbladet, 23. November 1910, Anders afrättning, Fogelström, Per Anders: Mödrar och söner, Bonnier, 1992 Joakim Forsberg: Liv för liv, Albert Bonniers, 2005 + Bildeinfügungen erichs-kriminalarchiv.com
13. Der Fall - Johann Schweida
Die ruhige Starhemberggasse (heute Graf Starhemberggasse) war am 3.5.1919 Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens geworden. Im Haus Nr. 5 war die greise Kammerdiener noch Gattin Luise Pawlik ermordet aufgefunden worden. Aus der Brust der Toten ragte ein Küchenmesser, der Kopf der Frau wies zahlreiche Hiebverletzungen auf. In der durchwühlten Wohnung fehlten die Ersparnisse der Familie, wertvoller Schmuck und ein Ballen Leinwand. Es lag also einwandfrei ein Raubmord vor.
Am 4. Mai1919 veröffentlicht das "Illustrierte Wiener Extrablatt" im Mittelteil folgende Artikel:
"Raubmord an einer Greisin
In einer der stillen Gassen des vierten Bezirkes, in denen sich nur einige Zinskasernen befinden, wurde gestern um die Mittagsstunde ein Raubmord an einer alten Frau verübt. Der Mörder hat in aller Ruhe die Kassen aufgebrochen, mehrere Juwelenetuis herausgenommen, das Beste ausgesucht und die leeren Etuis wieder zurückgelegt. Als die Tat entdeckt wurde, dürften kaum 2 Stunden seit ihrer Ausführung verflossen sein. Wir erfahren über das Verbrechen:
Der Stolz der Familie.
Im vierten Stock auf der zweiten Stiege des Hauses Nummer 5 der Starhemberggasse auf der Wieden hat seit etwa 35 Jahren der Kammerdiener des Präsidenten Arthur Kuffler, Herr Adolf Pawlik, eine bescheidene Wohnung inne. Sie besteht aus einer Küche und einem Kabinett, die nach dem Hofe gehen, und einem geräumigen Zimmer, das mit seiner behaglichen, reichen Einrichtung der Stolz der Familie war. Diese bestand aus dem Mann, der Frau Aloisia (oder Luise) Pawlik und der Tochter Mathilde.
Mann und Tochter.
Herr Pawlik weilt tagsüber auf seinem Posten und schläft auch nachts bei seinem Dienstgeber in der Eugengasse, sodass die Frau und ihre Tochter eigentlich die Wohnung allein bewohnen. Fräulein Mathilde Pawlik ist seit Jahren als Direktrice im Modesalon Lederer in der Bognergasse in gut bezahlter Stellung. Sie geht früh ins Geschäft und kommt erst frühestens um 3 Uhr nachmittags nach Hause. Die Mutter pflegte immer mit dem Mittagessen auf die Tochter zu warten. Die alte Frau war noch sehr rüstig und erfreute sich im Hause großer Beliebtheit. Am innigsten hatte sich Frau Pawlik an die Frau des von Wien abwesenden Zimmermalers Wacek angeschlossen. Frau Wacek machte Wege für sie, verschaffte ihr Milch und auf die eigene Fettkarte Speck beim Arbeiterkonsumsverein, der ihr selbst zu teuer war, kurz, sie stand ihr bei, wo sie konnte. Sie macht ihr auch wiederholt Vorwürfe, dass sie die Wohnungstüre nicht verschließe. Aber Frau Pawlik, gutherzig, wie sie selbst war, wollte nicht glauben, dass man gegen sie Böses im Schilde führen könnte.
Die Auffindung der Leiche.
Gestern war Frau Pawlik im Palais bei ihrem Manne, um das Monatsgeld abzuholen. Seitdem hat er sie nicht mehr lebend gesehen. Die Tochter hatte sich auch gestern früh wie sonst aus dem Haus entfernt, um ins Geschäft zu gehen. Sie hatte ihren Schirm vergessen und musste deshalb umkehren. Das war um etwa 1/4 10 Uhr. Dann machte Frau Pawlik ihr gewöhnliches Tageswerk, während Frau Wacek ausging, um Lebensmittel einzukaufen. Gegen 1/2 2 Uhr sah Frau Wacek nach ihrer Nachbarin; sie war gewohnt, die Türe offen zu finden und klinkte wie sonst auf; als sie einen Blick in die Küche warf, fand sie zu ihrem Schreck Frau Pawlik auf dem Boden liegen. Beim Kopfe war eine große Blutlache sichtbar, die Haare waren zerzaust. Frau Wacek glaubte, dass Frau Pawlik von Unwohlsein befallen worden sei und sich im Sturze den Kopf verletzt habe. Sie lief auf den Gang und rief zwei Nachbarinnen zu Hilfe. Diese wollten, mit der Frau Wacek, die scheinbar Bewusstlose aufheben; da sahen sie, dass ihr in der Brust ein großes Küchenmesser steckte.
Man verständigte das Polizeikommissariat Wieden, von dem sich alsbald Bezirksleiter Regierungsrat Schmidt mit dem Kommissär Dr. Prob und Oberezirksarzt Dr. Müller einfanden und den Tatbestand eines Mordes, nach den allerersten Erhebungen eines Raubmordes, feststellten. Nun wurden Sicherheitsbüro und Polizeipräsidium in Kenntnis gesetzt. Es fanden sich alsbald auf dem Tatorte der Chef der Kriminalsektion Regierungsrat Nickles, der Vorstand des Sicherheitsbüros Polizeirat Dr. Bruno Schulz seinem Stellvertreter Oberkommissär Wahl und Oberkommissär Matter, der Vorstand des Polizei- Agenteninstitutes Polizeirat Tandler und eine Anzahl auserlesener Polizeiagenten ein. Auch eine gerichtliche Kommission mit Professor Dr. Haberda erschien im Hause.
Indessen hatte man schonend den Gatten und die Tochter verständigt. Die Leiche wurde untersucht und es zeigte sich, dass sie eine schreckliche Hiebwunde an der rechten Scheitelseite hatte, mit Zertrümmerung des Schädels.
Das große Küchenmesser
steckte in der Brust und war ganz durch den Körper gedrungen. Die Mordwerkzeuge hat der Täter nicht mitgebracht. Die Frau hat sich vielleicht eben daran gemacht, im Herd zu heizen, als der Täter sie überfiel. Sie hatte begonnen, Speck in Stücke zu schneiden, und daher lag das Küchenmesser in Ihrer Nähe, dass der Mörder zu seiner Tat benutzte. Ein Kampf scheint der Tat nicht vorausgegangen zu sein. Sie wurde in der Zeit zwischen 1/2 12 Uhr und 1/2 2 Uhr ausgeführt. In der Meinung, dass Frau Pawlik noch zu retten sei, hatte man die Rettungsgesellschaft berufen, doch stellte der Arzt den Eintritt des Todes fest.
Es war gleich klar, dass ein
Raubmord
vorliegt, obwohl die Räume nicht die bei Raubmord ungewöhnliche Unordnung zeigten. Im Zimmer war der Wäschekasten erbrochen. Eine Schmuckkassette, die unter Wäschestücken versteckt war, lag auf dem Schreibtisch. In der Kassette waren bloß minderwertige Juwelen geblieben. Die Etuis der kostbaren Stücke waren leer vom Täter in die Kassette zurückgelegt worden. Nach den Angaben der Tochter, die trotz ihres grenzenlosen Schmerzes die Untersuchung unterstützte, fehlten folgende Stücke:
- eine kleine Brosche in Form eines etwa 2 cm langen und einem halben Zentimeter breiten Panzerkettenstückes;
- eine goldene Brosche mit großem Amethyst, der einen leichten nur von innen sichtbaren Sprung zeigt - der Amethyst ist von innen hohl gefasst und von Perlen umgeben;
- eine goldene Brosche in Form einer gebogenen Nadel, auf der sich Negerkopf befindet. Der Neger hat weißen Fez mit goldenem Stern mit Ruppin;
- eine goldene moderne schmale, lange Busennadel mit Rauchtopas, rund gefasst in kleinen Perlen;
- eine goldene Damenremontoluhr mit Doppelmandel (groß für eine Damenuhr), guillochiert mit glattem Felde in der Mitte, samt langer goldener Lorgnonkette, bestehend aus gewundenen Gliedern;
- ein goldener Damenring mit Opal;
- ein Rosettendamenring mit Saphir, umgeben von 9-10 Brillanten;
- ein breiter Damenring für kleinen Finger aus kalifornischem Rohgold mit halbgeschliffenem Smaragd;
- ein Damenring, bestehend aus flachem, breitem Reifen und in der Mitte ein Stück in Form einer Gürtelschnalle;
- ein mattgoldenes Armband ohne Zierrat in Form eines Gardinenringes;
- ein antikes, schmales goldenes Armband in Form zweier ineinander verschlungener Achter;
- ein goldenes Kettenarmband, dicht gegliedert, mit rundem Anhängsel, dass ein Mistelzweig in Emaille zeigt.
Dann wurde ganz unter einem Wäschestoß in dem mit Leinen vollgefüllten Kasten
- ein 28 Meter mal 70 Zentimeter langes Stück Leinen hervorgezogen und geraubt. Es ist erst im Jänner des Jahres gekauft und hatte 1291 Kronen und 50 Heller gekostet und war mit Seitenbündchen umwunden.
Möglicherweise ist aus der Fülle der Wäsche eines oder das andere Stück, das sich noch nicht übersehen lässt, geraubt. Es müsse die Märke "A. P." oder "L. P." tragen. Auch im Kabinett hat der Täter die beiden Kasten aufgebrochen und Schachtel mit Schuhen herausgezogen und auf das Bett gelegt, ohne augenscheinlich hier etwas zu stehlen. Man glaubte anfangs, dass noch das eine oder das andere Stück fehle:
- Silberzeug,
- ein Betrag von 3500 Kronen, der unter der Wäsche lag,
- ein Nippesstück,
doch alles andere fand sich später vor. Der Kasten, den der Täter im Zimmer erbrochen hat, zeigte die Spuren der gewaltsamen Öffnung; auch Fingerabdrücke wurden deutlich wahrgenommen und daktyloskopisch festgehalten. An die Wohnung der Familie Pawlik grenzt die der Familie Witeschnik. Neben der Türe ist ein Gangfenster, dessen Scheiben aber mit Papier verklebt sind. Frau Witeschnik gibt an, sie habe um etwa 11 oder 1/2 12 Uhr Uhr durch das verklebte Fenster die
Silhouette eines hoch gewachsenen Mannes,
der Havenlock trug, gesehen. Dann habe sie ein Klopfen an der Türe der Frau Pawlik gehört. Der Mann sei aber dann gleich wieder in der Richtung zur Stiege gegangen. Auffälliger noch sind zwei andere Aussagen. Ein Zufall will es, dass auf der ersten Stiege, im zweiten Stock, Tür Nummer 24, im Hause eine Frau Maria Pawlik wohnt. Zu ihr ist gestern ein Mann von etwa 20-22 Jahren gekommen. Er war mittelgroß, hatte leichten Bartanflug, trug lichten trapfärbenden Überzieher, lichten, in der Mitte eingedrückten, weichen Hut mit schmaler Krempe und hatte einen Zettel in der Hand. Er fragte nach einem Fräulein, das hier wohnen solle, das einen Stand im 10. Bezirk habe. Er war anscheinend ärgerlich darüber, dass er die Auskunft erhielt, dass die Gesuchte nicht hier wohne und entfernte sich langsam und nachdenklich. Schon am Dienstag, den 29. vergangenen Monats, war in einer anderen Wohnung im Hause auf der zweiten Stiege ein Mann, dessen Beschreibung der des Besuches von gestern gleicht. Er klopfte an und fragte das Dienstmädchen auf der Tür Nummer 33, ob hier Fräulein Pawlik wohne. Das Mädchen wusste nicht Bescheid und rief ihre Herrin. Diese wies ihn zu der Marie Pawlik auf der ersten Stiege, und der Bursche entfernte sich. Das gerade an zwei Tagen in dieser Woche nach dem Namen Pawlik im Hause gefragt wurde, lässt es womöglich erscheinen, dass der Besucher vom 29. vergangenen Monats und vom 2. diesen Monats mit der Mordtat in Zusammenhang zu bringen ist. Die Erhebungen werden eifrigst fortgesetzt.
Die Verhaftung des Täters.
Spätnachts wird uns gemeldet:
Der mutmaßliche Mörder der Frau Pawlik befindet sich bereits in Haft. Er ist der 21-jährige Privatbeamte Johann Schweida, der im selben Hause wie die Familie Pawlik, um einen Stock tiefer wohnt. Durch die Erhebungen wurde ermittelt, dass er öfters bei Frau Pawlik geweilt hat, wie es heißt, um mit ihr Lebensmittelgeschäfte zu machen.
Der junge Mann wurde einvernommen und gab zu, dass er tatsächlich Frau Pawlik öfters besuchte und dass er sie zuletzt gestern vormittags aufgesucht hat, angeblich, um sich eine Zeitung auszuleihen. Die Tat selbst stellt er aber auf das Entschiedenste in Abrede. Er sagt, er habe bald nach 11 Uhr das Haus verlassen und sei erst um 1/2 3 Uhr heimgekehrt. Bei der Heimkunft habe er von der Mordtat gehört.
In seinem Besitze wurden 600 Kronen gefunden, die angeblich von seinen Lebensmittelgeschäften herrühren. Es wurden aber die auf dem Tatorte vorgefundenen Fingerabdrücke des Täters mit jenen Schweidas verglichen, wobei sich die völlige Übereinstimmung herausgestellte. Der junge Mann wurde daher verhaftet und dem Sicherheitsbüro überstellt."
Bereits einen Tag später, also am 5. Mai1919, ergänzt bzw. erweitert das "Illustrierte Wiener Extrablatt" ihren Tags zuvor veröffentlichen Beitrag vom brutalen Verbrechen durch folgende Neuigkeiten.
Ich zitiere:
"Der Raubmord in der Starhemberggasse
Zwei Verhaftungen - Eine schwierige Schuldfrage.
Das Verbrechen, dem am Samstag die greise Kammersdienergattin Frau Aloisia Pawlik in ihrer Wohnung, 4. Bezirk, Starhemberggasse Nr. 5, zum Opfer gefallen ist, hat bisher trotz der bereits gemeldeten Verhaftung des im selben Hause wohnenden kostenlosen Privatbeamten Johann Schweida noch nicht seine volle Aufklärung gefunden. Dies hängt mit der Verhaftung eines zweiten jungen Mannes zusammen, der ein Jugendfreund Schweidas ist, sich gestern freiwillig bei der Polizei meldete, um anzugeben, dass Schweida ihn, und zwar vergeblich, zur Teilnahme an einem Einbruchdiebstahl bei Frau Pawlik aufgefordert habe und nun selbst von Schweida beschuldigt wird, der eigentliche Mörder der alten Frau zu sein, was er aber leugnet. Sache der Untersuchung wird es nun sein, festzustellen, welche Rolle jeder der jungen Menschen, die früher Freunde waren und jetzt Todfeinde sind, bei dem grausamen Verbrechen an der alten Frau gespielt hat.
Ein verdächtiges Interesse.
Als vorgestern nachmittags das Verbrechen entdeckt wurde, war Johann Schweida unter den vielen Personen, die sich vor der Wohnung der Ermordeten einfanden, eine der geschäftigsten. Als bereits die polizeiliche Kommission auf dem Tatorte weilte, hielt er sich fortwährend auf dem Gange auf und als der Gatte der Frau Pawlik aus dem Palais Kuffler, Prinz Eugen-Gasse Nr. 30, herbeigeholt werden sollte, machte sich Schweida sofort hierzu ernötigt. Er nahm eine Fiaker auf und brachte Herrn Pawlik in die Starhemberggasse. Den Kutscher entlohnte er für diesen kurzen Weg mit einer 50 Kronen-Note. Diese Freigebigkeit und das sonnige Gebaren des jungen Menschen, der Umstand, dass er im Hause wohnte und öfters bei Frau Pawlik gesehen worden war, lenkte die Aufmerksamkeit der polizeilichen Organe auf sich und ehe er noch ahnte, dass ihn ein Verdacht treffe, war bereits Anordnung getroffen worden, sich seiner Person zu versichern. Die Übereinstimmung der Fingerabdrücke an dem von dem Täter aufgesprengten Schrank und auf der ausgeplünderten Schmuckkassette mit den Fingerabdrücken Schweidas bestätigten den Verdacht und führten zu seiner Verhaftung. Er leugnete aber hartnäckig, mit der Tat in irgendeiner Beziehung zu stehen und wurde dem Sicherheitsbüro überstellt.
Die Anzeige des Schulfreundes - Gegenseitige Beschuldigungen.
Gestern früh erschien beim Polizeikommissariat Favoriten der 21-jährige Schlossergehilfe Franz Zidek, der in der Ettenreichgasse 9 wohnt, und verlangte, einem Beamten vorgeführt zu werden, da er bezüglich des Raubmordes, worüber er in der Zeitung einen Bericht gelesen habe, wichtige Angaben machen musste. Dem diensthabenden Kommissär vorgeführt, gab er an, Johann Schweida, seinem ehemaligen Schulfreund, sei am 1. des Monats zu ihm gekommen und habe versucht, ihn zur Teilnahme an einem Einbruchdiebstahl bei Frau Pawlik zu überreden, die sehr vermögend sei. Und zwar sollte Zidek nur einen Nachschlüssel zur Türe anfertigen. Zidek behauptet, er habe die Teilnahme an diesen Diebstahl rundweg abgelehnt und auch Schweida davon abgeraten, worauf sich dieser entfernt habe.
Aufgrund dieser Anzeige wurde Zidek dem Sicherheitsbüro überstellt, wo er seine Angaben wiederholte. Als er Schweida gegenübergestellt wurde, versuchte dieser, dem die Anzeige Zideks vorgehalten wurde, zu leugnen, dass er Zidek überhaupt kenne. Auf das unsinnige vieler Verantwortung aufmerksam gemacht, verstand er sich dazu, den Freund zu erkennen und gab nun zu, dass er tatsächlich an den Verbrechen beteiligt war. Er behauptet aber, nicht er sei der Mörder der alten Frau gewesen, sondern Zidek habe die Frau allein, ohne seine Hilfe ermordet, während er selbst nur an dem Diebstahl teilgenommen habe. Zidek dagegen bleibt dabei, dass er von der Tat nichts wisse, als was er beim Polizeikommissariat Favoriten angegeben habe und dass er gar nicht in die Wohnung der Frau Pawlik gekommen sei.
Schweida behauptet, dass ihn Zidek im Café Rebitzer in der Alleegasse aufgesucht und gesagt habe, ob er nicht wisse, wo ein Einbruch verübt werden könne, da er kein Geld habe. Am Freitag seien sie dann im Kaffeehaus endlich zusammengekommen, wo Schweida dem Zidek den Plan zu dem Einbruche bei der Frau Pawlik vorgelegt habe. Zidek habe versprochen, die Sperrhaken zu liefern und Schweida darauf aufmerksam gemacht, sich für Samstag vormittags ein Alibi zu sichern. Darauf habe Schweida mit der Kassiererin des Kaffeehauses gesprochen und ihr einen "Hunderter" angeboten, wofür sie nichts zu tun habe, als, falls sie gefragt würde, zu bestätigen, dass er Samstag vormittags im Kaffeehause gewesen sei. Die Kassiererin, die nicht wusste, um was es sich handelte, habe lachend ihre Zustimmung gegeben.
Vorgestern früh kamen die beiden Burschen in einem Volkskaffee in der Mayerhofgasse zusammen. Schon vorher hatte Schweida sich zu überzeugen versucht, ob in der Pawlikschen Wohnung jemand zu Hause sei, zuerst von der Gasse aus, und als ihm das nicht gelang, in dem er ins Haus ging und an der Tür klopfte. Während ihm geöffnet worden, so hätte er ein Lebensmittelgeschäft als Grund seines Besuches vorgeschützt. Es wurde aber nicht geöffnet, woraus er den Schluss zog, dass "die Luft rein sei" und holte nun Zidek aus dem Kaffeehause ab, um mit ihm gemeinsam den Einbruch zu verüben.
Als sie zur Wohnungstür kamen, fanden sie diese nicht mehr versperrt und Zidek ging voraus in die Wohnung, während Schweida nach seiner Angabe auf dem Gange als Aufpasser zurückblieb. Gleich darauf hörte er in der Wohnung einen dumpfen Fall und ging nun auch selbst hinein. Er sah, wie er behauptet, Frau Pawlik in der Küche auf dem Boden liegen, doch steckte das Messer noch nicht in ihrer Brust. Er kümmerte sich angeblich nicht darum, was in der Küche vorgegangen war, sondern ging in das Kabinett, wo er aus einem Kasten 100 Kronen nahm. Er hatte schon gelegentlich seiner Besuche bemerkt, dass Frau Pawlik in diesem Schrank ihr Geld aufzubewahren pflegte. Dann ging er mit Zidek ins Zimmer, wo sie Kasten, Kredenz und Schreibtisch durchsuchten, bis sie im Kasten, unter der Wäsche versteckt, die Schmuckkassette und ein Stück Leinwand fanden. Den Schmuck sollte Zidek an sich genommen haben, mit Ausnahme einer Uhr, die Schweida behielt.
Während dieser Durchsuchung hörte Schweida Frau Pawlik in der Küche stöhnen. Zidek eilte daraufhin in die Küche und Schweida hörte mehrere dumpfe Schläge, worauf es in der Küche ganz still wurde.
Sie verließen nun mit ihrem Raub die Wohnung und trennten sich vor dem Haustore. Schweida gibt an, dass er sich zunächst zu einem Zuckerbäcker begeben habe, um eine Schuld von 10 Kronen zu bezahlen. Dann suchte er das Volkskaffeehaus in der Mayerhofgasse auf und endlich ging er in die Stadt, wo er die Uhr um 300 Kronen verkauft haben will. Wo Zidek den Schmuck verborgen oder veräußert habe, wisse er nicht, doch habe Zidek ihm vor der Tat gesagt, dass er einen verlässlichen Hehler wisse.
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass außer den bereits aufgezählten Schmuckstücken auch ein goldenes Medaillon mit schwarzer Evaluierung und ein goldenes Armband in bosnischer Filigranarbeit geraubt wurden.
Es ist möglich, dass die Angaben Schweidas der Wahrheit entsprechen und viele Details, die er angibt, machten den Eindruck als könnten Sie nicht erfunden sein. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass er sich auch schon vor dem Auftreten Zideks sehr kaltblütig benahm und dass sein absolutes Leugnen den Eindruck großer Aufrichtigkeit machte. Zudem wurde er bereits als 14-jähriger Bursche wegen Diebstahls mit einem Monat Arrest bestraft. Während seiner Militärdienstzeit im Kriege war er als Schreiber einem Militärgerichte zugeteilt und hatte so Gelegenheit, seinen Blick für die Schwächen und Stärken der verschiedenen Verantwortungsmethoden Beschuldigter, für die Tragweite dessen, was sie zugeben oder leugnen, zu schärfen, denn er wurde oft als Schriftführer verwendet. Er scheint nicht ohne Nutzen durch diese Schule gegangen zu sein.
Merkwürdig berührt seine Angabe, er und Zidek hatten vor der Tat auch eine Kartenaufschlägerin aufgesucht, um sie zubefragen, ob ihr gemeinsames Vorhaben "gut ausgehen" werde, was die Wahrsagerin aufgrund ihrer Karten auch bejaht habe.
Die Mörder ohne Mordwerkzeug.
Sehr zugunsten der Verhafteten und die von Schweida gemachte Behauptung, dass es sich bei dem Verbrechen um einen Einbruchsdiebstahl gehandelt habe, spricht der Umstand, dass die Schläge auf den Kopf, wodurch Frau Pawlik getötet wurde von einem Hammer herrühren, der, ebenso wie das Messer, das in der Brust der Toten steckend aufgefunden wurde aus dem Besitze der Ermordeten stammen. Der Täter, ob es sich nun um Schweida oder Zidek handelt, hat somit kein Mordinstrument mitgebracht, es sei denn, dass Schweida den Hammer schon bei einem früheren Besuche in der Wohnung der Frau Pawlik entwendet oder dort bereits für seinen verbrecherischen Plan zurechtgelegt hat. Diese Frage bedarf noch gründlich der Aufklärung."
Die Verhöre im Polizeikommissariat laufen indes kontinuierlich weiter. Das "Illustrierte Wiener Extrablatt" informierte auch am Dienstag, den 6. Mai 1919, seine Leser über die neuesten polizeilichen Entwicklungen bei der Aufklärung des heimtückischen Raubmordes.
Das Blatt führt aus:
"Der Raubmord in der Starhemberggasse.
Gegenseitige Anklage der verhafteten Freunde.
Die Untersuchung über den Mord an der Kammerdienersgattin an Aloisia Pawlik stellt die Behörden aus den teils dargelegten Gründen vor eine ungemein schwierige Aufgabe. Die als mutmaßliche Täter in Haft befindlichen jungen Burschen blieben auch gestern bei wiederholten Verhören im Sicherheitsbüro bei der von ihnen gewählten Verantwortung. D. h., dass Schweida nach wie vor behauptet, dass nicht er, sondern sein Freund Franz Zidek der eigentliche Mörder der alten Frau sei, während Zidek nicht nur seine Teilnahme am Morde, sondern auch an dem Einbruchdiebstahle, der nach Angabe Schweidas zu dem schweren Verbrechen führte, hartnäckig leugnet. Der Umstand, dass Schweida anfangs der von ihm behaupteten Mitschuld Zideks mit seinem Worte Erwähnung getan hatte und erst am Sonntag, als ihm Zidek gegenübergestellt wurde, mit seiner Beschuldigung herausrückte, spricht allerdings dafür, dass ihm erst in diesem Augenblick der Einfall gekommen sein könnte, dem Freund die Blutschuld aufzuhalsen. Im Laufe des gestrigen Tages wurden sowohl Schweida als auch Zidek wiederholt einzeln einvernommen und auch einander gegenübergestellt, ohne dass sie ihre Verantwortung änderten.
Unter dem Namen des Freundes.
Die Uhr, die Schweida als seinen Beuteanteil behielt, wurde gestern zustande gebracht. Schweida hat sie am 3. des Monats einem Goldarbeiter in der Sterngasse um 300 Kronen verkauft. Der Goldarbeiter fragte ihn zur Sicherheit um seinen Namen und Schweida unterschrieb den Zettel, auf dem er Namen und Adressen bekannt geben sollte, nicht mit dem eigenen Namen, sondern unterfertigte "Karl Zidek, 10. Bezirk Ettenreichgasse Nr. 9". Er hatte sich also den Namen seines Freundes beigelegt, nur mit dem Unterschiede, dass Zidek mit dem Vornamen Franz heißt. Er hatte also schon damals die Absicht im Notfalle seinen Freund zu belasten. Die übrigen der Frau Pawlik geraubten Juwelen und die Leinwand sind bisher noch nicht zustande gebracht worden. Es wäre sehr wesentlich für den Verlauf der Untersuchung, wenn sich Geschäftsleute melden wollten, die eines der der Frau Pawlik geraubten Stücke, deren Liste im Sonntagsblatt veröffentlicht wurde, seither gekauft haben.
Das misslungene Alibi die Decks.
Zidek hat gestern verschiedentlich versucht, ein Alibi für die kritische Zeit zu erbringen. Dieser Versuch ist aber gänzlich misslungen. So behauptete er, er sei zur Zeit des Mordes im Café Rebitzer auf der Wieden gewesen. Die Kassiererin des Kaffees konnte aber mit vollster Bestimmtheit erklären, dass diese Behauptung nicht wahr ist. Bemerkenswert ist, dass Zidek nach dem Morde einen Freund in das Kaffeehaus bestellt hat, dem er die Mitteilung machte, dass ihm sein Vater 250 Kronen geben werde, damit er wieder "ein anständiger Mensch" werde. Diese Behauptung ist völlig erfunden und man vermutet, dass sie Zidek damit die Absicht verfolgte, den künftigen Besitz von Geld aus dem Erlös der erbeuteten Juwelen zu erklären."
Der Vernehmungsdruck auf Johann Schweida und Franz Zidek wächst beständig. Die Vernehmer lassen nicht locker, ...bis einer der Angeschuldigten, völlig in die Enge getrieben, zusammenbricht und gesteht. Das Illustriertes Wiener Extrablatt vom Mittwoch den 7. Mai 1919 berichtet darüber.
"Der Raubmord in der Starhemberggasse.
Johann Schweida der alleinige Täter. - Sein Geständnis.
Das Verbrechen, dem die greise Kammerdienersgattin Aloisia Pawlik zum Opfer gefallen ist, hat gestern durch das Geständnis des verhafteten Johann Schweida, dass er allein den Mord an der unglücklichen Frau verübt und dass sein Freund Franz Zidek der Tat vollständig ferne stehe, seine volle Aufklärung gefunden. Durch dieses Geständnis erscheint Franz Zidek von dem furchtbaren Verdachte, den der eigentliche Täter auf ihn abwälzen wollte, vollkommen gereinigt und die Wahrheit der von ihm gemachten Angaben zur Gänze erwiesen.
Das verpfuschte Leben des Raubmörders Johann Schweida endet mit einer lebenslänglichen Kerkerstrafe.
Der junge Mann wurde daher noch gestern enthaftet. Es muss betont werden, dass gegen ihn überhaupt kein anderer Verdachtsgrund vorlag, als die mit großer Hartnäckigkeit vorgebrachte Beschuldigung seitens des Schweida, der trotz aller Verhöre und Konfrontierungen dabei blieb, dass Zidek es gewesen sei, der die alte Frau gelegentlich, des von Ihnen angeblich gemeinsam geplanten und verübten Einbruchsdiebstahls, niedergeschlagen und getötet habe. Er wusste seiner Erzählung durch die raffinierte Erfindung von allerlei Einzelheiten den Anschein der Wahrheit zu geben, sodass Zidek dadurch tatsächlich schwer belastet schien. Dazu kam noch der Umstand, dass Zidek, aufgefordert, zu sagen, wo er den kritischen Vormittag verbracht habe, Angaben machte, die sich bei der Überprüfung als unrichtig herausstellten. So geriet er, obwohl völlig unschuldig, in eine äußerst schwierige Lage. Allem Anscheine nach ließ sich Schweida, bei seiner Beschuldigung gegen den ehemaligen Freund, nicht nur von der Hoffnung leiten, den Verdacht auf ihn abzulenken, sondern auch von Rachsucht. Und zwar aus dem Grunde, weil Zidek sich freiwillig bei der Polizei gemeldet und verraten hatte, dass er von Schweida aufgefordert wurde, sich an einem Einbruche bei Frau Pawlik zu beteiligen.
Die Mordwaffe und der geraubte Schmuck gefunden. - Das Versteck unter der Kehrichtkiste.
Nur nach schweren inneren Kämpfen und eindringlichen Vorstellungen des ihn verhörenden Oberkommissär Dr. Mathes entschloss sich Schweida gestern vormittags im Sicherheitsbüro zu dem Geständnis und zum Widerruf der gegen Zidek erhobene Beschuldigung. Er hat die alte Frau mit einem schweren Hammer niedergeschlagen und ihr dann das Küchenmesser in den Leib gerannt. Als Schweida verhaftet wurde, fand man bei ihm ein Rasiermesser, womit er vermutlich den Hals seines Opfers durchschneiden wollte. Frau Pawlik war aber, als der Überfall erfolgte, eben mit dem Schneiden von Speck beschäftigt und so benützte er, statt des mitgebrachten Rasiermessers, das große Küchenmesser, womit sie Speck geschnitten hatte, als Mordwaffe.
Dann erbrach er den Kasten und raubte den Schmuck. Seine Beute war größer als bisher angenommen wurde, da von den Angehörigen der Frau Pawlik bei der Zusammenstellung des Verzeichnisses auch einzelne Stücke vergessen wurden. Er gestand, den Schmuck und den Hammer, der ihm als Mordwerkzeug gedient hatte, unterhalb einer städtischen Kehrichtkiste, die in der der Theresianumgasse aufgestellt ist, verborgen zu haben. Tatsächlich wurden diese Gegenstände in dem angegebenen Versteck von Polizeiagenten aufgefunden und in der Sicherheitsbüro gebracht. An dem blutbefleckten Hammer klebten noch Haare des bedauernswerten Opfers. Die geraubte Uhr hat Schweida, wie schon erwähnt, einem Goldarbeiter in der Sterngasse um 300 Kronen verkauft. Sie wurde dort zustande gebracht. Ferner hatte Schweida aus dem Geldtäschchen der Frau Pawlik, die kurz vorher vom Einkaufen zurückgekommen war, 30 Kronen herausgenommen. Mit diesem Gelde löste er sofort nach dem Mord seine eigene Uhr aus, die er einige Tage vorher bei einem Trödler verpfändet hatte.
Schweida wird demnächst dem Landesgerichte eingeliefert werden. Er wird sich außer wegen des Raubmordes auch wegen Verleumdung Zideks zu verantworten haben."
Kurze Zeit später wurde Johann Schweida vor Gericht gestellt und zu einer lebenslänglichen Kerkerstrafe verurteilt.
Im Jahre 1936 hatte man ihn vorzeitig begnadigt. Schweida wurde aber 1937 wegen eines Diebstahls erneut in Haft genommen, wo er im Februar 1938 eines natürlichen Todes starb. Das Ende einer tragisch menschlichen und verbrecherischen Karriere.
Quellen: Illustriertes Wiener Extrablatt vom Mai 1919 - Tatort Wien - 1. Band (von Edelbacher/Seyrl) Ausgabe 2004 - S. 103 - ISBN 3-911697-09-8 - Textergänzungen erichs-kriminalarchiv.com
14. Der Fall - Paul Tippe
Durch die Potsdamer Straße in Berlin flutet in den Abendstunden des 6. November 1910 straßenauf, straßenab der lebhafte Sonntagsverkehr. Die Ausflügler kommen von draußen herein, einzeln oder in kleinen Trupps, Freunde und Freundinnen, Jungens und Mädels, greise Ehepaare in bedächtigem Schritt, junge Liebe mit fröhlichem Lachen, müde Großväter und Großmütter mit Kindern und Enkeln. Laufmüde und hungrig füllen andere die Straßenbahn und freuen sich über jeden glücklieh eroberten Platz.
An der Ecke der Potsdamer- und der Göbenstraße steigt gegen halb neun Uhr abends ein junger Ehemann aus der Straßenbahn, sein kleines, vier Monate altes Kindchen besorgt an sich drückend und hilft dann ritterlich seiner jungen Frau beim Aussteigen. Vorsichtig geht das Ehepaar schräg über die Straße und tritt in das Eckhaus Potsdamer Straße 83 ein. Es ist der Schneidermeister Tetzke, der mit seiner Frau den Sonntag in einem Vorort Berlins bei seinen Schwiegereltern verbracht hat. Tetzke und seine Frau plaudern noch von den alten Leuten, die so innigen Anteil an ihrem jungen Glück nehmen, während sie zu ihrer Wohnung im dritten Stock emporsteigen. Auf der Treppe geht die Frau voraus, um die Tür aufzuschließen und rasch in der Wohnung Licht zu machen. Tetzke folgt mit dem schlafenden Kind auf dem Arm behutsam nach. Er hat gerade den Fuß über die erste Schwelle der letzten Treppe gesetzt, als seine Frau die Wohnung betritt. Er ist noch auf halber Treppe, da hört er plötzlich einen furchtbaren Schrei seiner Frau, der jäh abbricht in dem Dröhnen eines Schusses. Eine entsetzliche Angst um seine Frau reißt ihn in zwei, drei Sprüngen die Treppe hinauf. Er stürzt in die Wohnung und prallt mit einem fremden Mann zusammen, der mit dem Revolver in der Hand zur Türe hinaus will. Tetzke läßt das Kind zu Boden gleiten und packt den Mann, da blitzt es schon aus dessen Waffe und Tetzke taumelt, durch Mund und Hals geschossen, zurück. Er will noch hinter dem Mordbuben her, der an ihm vorbei durch die Flurtür springt, aber auf dem Treppenabsatz taumelt er kraftlos und stürzt schwer zu Boden. Hausbewohner, die auf das Krachen der Schüsse herbeieilen, sehen nur noch schattenhaft einen Mann die Treppe hinunterjagen und aus dem Hause laufen. Im Straßendunkel und im Strom der Passanten ist er im Nu verschwunden. Die Hausbewohner tragen den bewußtlosen Tetzke auf ein Bett und finden dann seine Frau, aus einer tödlichen Schußwunde im Kopfe blutend, ohnmächtig an der Küchentür zusammengesunken. Das Kind sitzt weinend aber unversehrt neben der Flurtüre am Boden.
Die Wohnung ist nach Geld und Wertsachen durchwühlt und die vielen ausgezogenen Schubläden und Kästen mit ihrem auseinandergerissenen Inhalt sprechen davon, daß in der Wohnung ein Einbrecher an der Arbeit gewesen ist, der von dem heimkehrenden Ehepaar überrascht wurde.
Als den Einbrecher das Straßengewühl aufgenommen hat, ist er auf eine vorüberfahrende Straßenbahn gesprungen und ziellos mit ihr davongefahren. Im Wagen fröhliche Menschen auf der Fahrt nach Hause oder auf dem Wege zu einem Vergnügen, lustig und guter Dinge. Und zwischen ihnen sitzt mit bebendem Gesicht, bald rot in der Hitze, bald bleich in der Kälte des Fiebers seiner Erregung der Mörder. Die eine Hand krampft sich um seine erbärmliche Beute, ein paar Mark Kleingeld aus einer Kindersparkasse, eine Damenuhr, vielleicht dreißig Mark wert, - welche Schuld hat er um diesen Bettel auf sich geladen! Und wenn er die Hand, die geschossen hat, in der Tasche verbirgt, dann stößt sie gegen den kalten Revolverlauf, und ein Frieren geht ihm bis ins Mark. Wenn jetzt einer der lächelnden Nachbarn ihn schärfer ins Auge fassen würde, und wenn er sich darauf verstünde, in Gesichtern zu lesen, so würde ihm das Lachen vergehen vor diesem Gesicht und vor diesen Augen, aus denen Angst und Seelenqual starrt.
Am Botanischen Garten treibt es ihn heraus aus der Straßenbahn, weg von all diesen fröhlichen Menschen. Ein paar Minuten steht er unschlüssig. Dann zieht es ihn hinein in eine andere Bahn, und er fährt denselben Weg zurück.
Um das Mordhaus stehen dicht gedrängt die Menschen, vor den vordersten Reihen, im Viereck um den Hauseingang, blinken Schutzmannshelme, Kriminalbeamte betreten das Haus oder kommen eilig heraus, und der Mörder wirft scheue Blicke nach ihnen, wie auf den Jagdhund ein sich im Gestrüpp drückendes Wild. Er tritt in der Menschenmenge von Gruppe zu Gruppe, aber jedes Wort, das er auffängt, ist ein Fluch für ihn und eine Verdammung. Vielleicht versteht er jetzt, daß einer, der seine Hände mit Menschenblut befleckt hat, seinen Weg für immer verloren hat, daß er zu einem Ausgestoßenen geworden ist unter den Menschen.
Daß es den Mörder zurückzieht an den Ort seiner Tat - wie es diesen Mann zurücktrieb vor das Haus, aus dem er vor knapp einer Stunde in wilder Hast geflohen war - ist durch Erfahrung verbürgt, solange es Mord und Mörder gibt. Der Mörder, der bald nach der Tat an ihre Stätte zurückkehrt, mag ausspähen wollen, ob die Tat schon entdeckt ist. Oder ihn mag die Absicht leiten, nach weiterer Beute zu suchen oder Spuren noch schnell zu verwischen. Oder er will in der Nähe sein, wenn die Polizei an die Arbeit geht, will sehen, was sie tut, will ihre Schritte heimlich beobachten. Es drängt ihn wohl auch zu hören, was die Leute reden und was sie mutmaßen, ob sein Name vielleicht schon genannt wird.
Das ist alles erklärlich und erklärt doch das eine nicht, warum es auch dann manchen Mörder noch zu der Mordstätte zieht, wenn er sich schon sicher fühlen kann, wenn auf dem Grabe des Opfers das Gras schon wächst.
Es muß da noch etwas anderes sein... Hat das Blut des Erschlagenen geheime Gewalt? Die graue Vorzeit glaubte es so. Man zwang den Verdächtigen vor die Leiche des Opfers und wachte, ob aus den Wunden das Blut frisch zu rinnen beginne. Aus Siegfrieds Todeswunde brach ein letzter Blutstrom, als Hagens Gestalt ihren Schatten über seine Bahre warf ...
Hat das Blut Erschlagener wirklich geheime Gewalt? Das Blut hat keine, aber die Tat hat sie! Gott oder die Natur hat es so gefügt, daß sich mit jeder Uebeltat der Täter selbst eine Wunde schlägt. Nur wenige, ganz rohe, ganz stumpfe, innerlich verdorrte Menschen fühlen diese Wunde nicht, die man Reue nennt. Reue ist Seelenqual, aber der Bereuende fühlt sie wie einen nagenden heftigen körperlichen Schmerz. Wer schon einmal ein Unrecht tief bereut hat, der weiß, daß es ihn dann hintrieb in die Nähe des Verletzten, um wieder gutzumachen. Und da, wo nichts mehr gutzumachen ist, weil keine Reue Tote wiedererweckt, und wo der Täter sich dem Erschlagenen nicht mehr nähern kann, ohne sich zu verraten, oder weil er nicht weiß, wo sein Körper ruht, da treibt es ihn zurück an die Stelle, wo er ihn zuletzt lebend sah, an den Schauplatz der Tat.
Mit dieser Stätte ist sein Schicksal verknüpft, sie steht immer wieder vor seinen Gedanken. Erinnerungen lassen sich nicht fortscheuchen. Im Wachen und Träumen lebt ihr Bild vor ihm auf, tausend Gedankenfäden spinnen sich von ihm zu ihr, wie mit tausend Fäden zieht ihn die Mordstätte an. Gedanken, in die sich ein Mensch verspinnt, gewinnen allmählich Gewalt über ihn und binden und zwingen und ziehen wie starke Stricke.
Der Mörder hat sich aus der Menge gelöst, die noch immer das Haus dicht umsteht, und irrt planlos durch die Straßen, bis er sich in der Sedanstraße wiederfindet, wo er bei Verwandten wohnt. Seine Verwandten bemerken wohl sein verstörtes, niedergeschlagenes Wesen, aber sie sehen daran nur Zeichen der Scham darüber, daß er ihnen vor einigen Tagen einen kleinen Geldbetrag entwendet und ihnen den Diebstahl, zur Rede gestellt, hat eingestehen müssen. Er verkriecht sich ins Bett, und am anderen Morgen verläßt er schon früh die Wohnung. Wieder irrt er in den Straßen umher, allein mit sich und seinen Gedanken. In den Morgenzeitungen findet er die Nachricht, daß Tetzke noch in der Nacht im Krankenhause seiner Verletzung erlegen ist. Nachmittags wagt er sich wieder unter Menschen. Auf dem Arbeitsnachweise mischt er sich wie früher unter die Arbeitsuchenden. Er trifft auf einen Bekannten und streckt ihm die Hand zum Gruße hin, aber der andere schlägt nicht ein. Befremdet blickt er auf, da hört er sich mit seinem Namen angerufen, und Kriminalbeamte stehen neben ihm. In jähem Entsetzen fährt er auf und sinkt dann in sich zusammen. Die Kälte einer Stahlkette gleitet um sein Handgelenk, starke Fäuste packen ihn und schleppen ihn weg.
Der Verhaftete ist der zwanzigjährige stellenlose Gärtner Paul Tippe, ein mittelgroßer, schlanker Mensch mit hagerem, blassem, bartlosem Gesicht. Er versucht zu leugnen. Er könne sein Alibi erbringen. Gewiß, eine Verwandte von ihm sei bis vor kurzem bei Tetzkes als Dienstmädchen in Stellung gewesen, aber beweise das vielleicht schon, daß er der Mörder sei? Da reißt der Kommissar die Zimmertür auf, im Türrahmen steht ein junger Mann, und Tippe sieht in ein bekanntes Gesicht.
Da bricht er auf einem Stuhl nieder und gibt sich gefangen. Den Mann in der Tür kennt er vom Arbeitsnachweise her, und Tippe weiß, was er der Polizei erzählt haben wird . . .
Er hat der Polizei erzählt, daß Tippe ihn vor einer Woche zu einem Einbruch in der Wohnung eines Schneiders, der in der Potsdamer Straße wohne, habe überreden wollen. Der Schneidermeister habe immer viel Geld im Hause, und er wisse aus einer gelegentlichen Aeußerung einer Verwandten, die dort in Stellung sei, wo er das Geld verwahre.
Tippe schildert nun selbst die Tat. Was die Kriminalpolizei am Tatort festgestellt hat, ist richtig. Er hat am Sonntag nachmittag auf der Treppe des Tetzkeschen Wohnhauses zwischen dem zweiten und dritten Stock aus dem Flurfenster einen schmalen Seitenteil mit einem Stemmeisen herausgenommen, hat sich durch die schmale Oeffnung hindurch auf einen Mauervorsprung herausgezwängt, der galerieartig in Höhe des zweiten Stocks um die Hofwand des Hauses läuft. Als er da zwischen Himmel und Erde stand, kam eine Frau die Treppe hinaufgestiegen. Vor dem ausgehobenen Fensterflügel stutzte sie, und der Kletterer, der sich ein paar Meter unter ihr hart an die Wand drückte, sah sie ihren Kopf durch die scheibenlose Oeffnung recken. Aber der Frau ist nicht in den Sinn gekommen, daß jemand durch das Fenster nach unten geklettert sein könne, und sie blickt nur nach oben. Tippe sieht ihren Kopf wieder verschwinden und hört ihre Schritte auf der Treppe verhallen. An der Hauswand entlang preßt er sich bis zur Regenkandel und klimmt an ihr bis zur Tetzkeschen Wohnung empor, in die er sich durch das offene Fenster schwingt.
An dem einen Blick der Frau hat das Leben der Tetzkeschen Eheleute gehangen. Hätte sie ein wenig gründlicher Umschau gehalten, ein wenig sorgsamer sich über ihren Verdacht vergewissert, dann war der Einbrecher entdeckt, und die Schüsse in der Tetzkeschen Wohnung wären nicht gefallen...
Tippe findet in der Wohnung das Geld nicht, nach dem er verzweifelt sucht. In Kommoden und Schränken, in Kästen und Fächern sucht er, er durchwühlt die Betten, reißt Wäschestücke auseinander, er faßt hinter die Möbel, greift in Kartons und tastet die Kleidungsstücke ab ... Er sucht und sucht... Und vergißt alles darüber... Nur das Geld ... wo ist das Geld? ... Da klirrt an der Flurtüre ein Schlüssel ins Schloß. Tippe steht wie gelähmt. Frau Tetzke kommt in die Wohnung und schreit auf, als sie auf den Einbrecher stößt. Tippe schießt - er springt vorbei an der niedersinkenden Frau - er steht vor dem Mann - er hat die Pistole noch hoch in der Hand, er schießt wieder und gewinnt die Freiheit. - ... Auf vierundzwanzig Stunden! . . .
Frau Tetzke ist nach wenigen Tagen ihrem Manne in den Tod gefolgt.
Tippe wurde zu lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. Nicht wegen vorbedachten Mordes - auf Mord steht die Todesstrafe -, sondern weil er bei Begehung eines Verbrechens, um sich der Ergreifung zu entziehen, Menschenleben vernichtet hat.
Lebenslängliches Zuchthaus! Ob Tippe oder ein anderer - viele büßen hinter Anstaltsmauern die gleiche Schuld, verbüßen die gleiche Strafe. Wenn man ihr Schicksal hinstellen könnte vor jeden, in dem der Gedanke keimt, über eine Bluttat den Weg zu fremdem Gelde zu gehen! Wenn man ihm erklären könnte, nicht nur, wie verwerflich und schlecht, nein, auch wie wahnwitzig dumm jede Bluttat ist, und welches Verbrechen der auch an sich selbst und an seinem eigenen Leben begeht, der um Geld die Waffe gegen einen Menschen hebt. Oft genug um eine Bettelsumme, um ein bißchen Plunder, um ein Nichts!
Wenn man ihm zeigen könnte, wie gräßlich anders die verübte Tat aussieht, die so verlockend erschien, als sie nur erst geplant war. „Ein anderes Antlitz, ehe sie geschehen, ein anderes zeigt die vollbrachte Tat!" Und wenn man ihm zeigen könnte, wie furchtbar die drohende Strafe ist! Die Gewissensangst, die Reue, die Seelenqualen. Die Monate vor dem Urteilsspruch, die Wochen nach dem Todesurteil, die Nächte vor der Hinrichtung und die letzte Stunde!
Oder - lebenslängliches Zuchthaus! Endlos lange Jahre hinter Steinmauern und Eisengittern eingeschlossen sein wie ein Tier im Käfig.
Draußen lacht die Sonne, draußen blühen die Blumen, draußen grünen die Bäume, draußen singen die Vögel. Ihn umschließen jahraus, jahrein, Sommer und Winter, immer dieselben kahlen, engen Kerkerwände. Er hört tagaus, tagein immer das gleiche Klirren der Schlüssel, immer die gleichen schweren, schleppenden Schritte der Wärter. Draußen die Menschen in ungebundener Freiheit - für ihn Zeit seines Lebens nur noch der eine Rundgang im öden Anstaltshofe. Draußen scherzen und plaudern die Menschen miteinander, teilen ihre Freuden und ihre Sorgen, vertrauen ihre Pläne und ihr Hoffen einander an - er hat keinen mehr, der teil an ihm nimmt, er kann niemandem mehr von seinem Erleben erzählen - er erlebt ja nichts mehr...
Lebenslängliches Zuchthaus heißt: - Tot sein bei lebendigem Leibe.
Quellen: Kriminalfälle (Liebermann von Sonnenberg und Otto Trettin) Ausgabe 1934 - S.104 + Text- und Bildergänzungen durch erichs-kriminalarchiv.com
15. Der Fall - Lothar Valenta
Am Morgen des 31. Oktober 1918 wurde zwischen den Buden des Praters die Leiche eines kleinen Praterunternehmers namens Ernst Valenta gefunden. Er war mit einer Zimmermannsaxt erschlagen worden. Die leeren ausgestülpten Taschen seiner Kleidung ließen auf einen Raubmord schließen.
Bereits am nächsten Tag konnte der Mörder gefasst werden und die Öffentlichkeit war über die Hintergründe der Tat zutiefst betroffen. Der eigene Sohn, Lothar Valenta hatte den Raubmord an seinem Vater begangen.
Lothar Valenta war bereits mehrmals zum Dieb an den eigenen Eltern geworden und sich selbst, wie er später erklärte, zum Lebensziel gesetzt, ein „großer, erfolgreicher Einbrecher zu werden". Am frühen Morgen des 31. Oktober sollte er mit dem Vater zu einer „Hamsterfahrt" nach Niederösterreich aufbrechen. Nahe der elterlichen Wohnung, in einer kleinen Gasse zwischen den Holzbuden und noch unter dem Schutz der morgendlichen Dämmerung, ermordete Lothar seinen Vater um sich das für den Einkauf bestimmte Geld anzueignen. Nach dem Mord überfiel er auch die noch zu Bett liegende Mutter und raubte die von ihr verborgenen Sparbücher. Trotz der Tarnung durch eine Uniform und gefälschten Papieren konnte er wenig später verhaftet werden.
Im März 1919, bereits in der jungen Republik, stand der Vatermörder vor den Schranken des Gerichtes. Er wurde des Raubmordes für schuldig befunden und zu fünfzehn Jahren schweren Kerker verurteilt.
Die tödliche Lungentuberkulose beendete jedoch schon nach einem Jahr die Haft des Vatermörders - er starb am 24. März 1920 hinter den Mauern der Strafanstalt Stein.
Quellen: Tatort Wien - 1. Band - Die Zeit von 1900 - 1924 (Edelbacher / Seyrl) Ausgabe 2004 - S. 71 - ISBN 3-911697-09-8 + Bildeinfügung erichs-kriminalarchiv.com